
In vielen Regionen unserer Welt entstehen neue oder wachsen bestehende Kirchengemeinden. Dabei hat sich das geographische Zentrum von der nördlichen Halbkugel in die südliche verschoben. Während beispielsweise in China, Indien oder Lateinamerika das Christentum wächst, werden viele Länder Europas zunehmend als Missionsländer wahrgenommen. Auch Deutschland ist, nicht zuletzt wegen der Selbstsäkularisierung der Kirchen und der sich ausbreitenden Konfessionslosigkeit, längst wieder ein Missionsgebiet geworden. Während beispielsweise in Chile knapp 20 Prozent der Einwohner lebendige Christen sind, gelten in Deutschland nur ungefähr 2,5 Prozent als Gläubige.
Die bekenntnisorientierten Kirchengemeinden Deutschlands brauchen deshalb nicht nur ein Herz für die Weltmission, sondern auch für die lnlandsmission. Die Gründung und geistliche Neuausrichtung von Gemeinden wird in den nächsten Jahrzehnten eine der größten Herausforderungen für die Christen in Zentraleuropa werden.
Ich möchte deshalb mit einigen persönlichen Denkanstößen zur Mission heute schließen:
Jünger machen. Es lohnt sich, den »Missionsbefehl« gründlich zu lesen. Es sei hier nur kurz darauf hingewiesen, dass es dort nicht heißt: »Ruft zur Bekehrung auf«, sondern »macht zu Jüngern«. Die beiden Mittelwörter »taufen« und »lehren« konkretisieren das »Jüngern«. Nachfolger Jesu lernen die Glaubensinhalte, die ihr Herr ihnen hinterlassen hat (»lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe«). Sie gehorchen dem, was sie gelernt haben. Das Evangelium von Jesus Christus stiftet unter allen Völkern den »Glaubensgehorsam« (vgl. Röm 16,25-27). Evangelisation, die nur zur Bekehrung aufruft, um Menschen »in den Himmel zu bringen«, greift zu kurz.
Bekenntnisgebundene Mission. Da in den letzten hundert Jahren Fragen des rechten Glaubens durch Pragmatismus und Gemeinschaft verdrängt worden sind, gilt es, die einende und festigende Bedeutung des Glaubensbekenntnisses wiederzuentdecken. Gemeinde kämpft für den Glauben, »der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist« (Jud 3). Bekenntnisse sind Kurzformeln, in der »die biblische Botschaft brennglasartig zusammengefasst wird, in der das unaufgebbare Soll, die ›eiserne Ration‹ christlicher Wahrheit ›fest-geschrieben‹ wird.« Obschon der Glaube in der Bibel primär als persönlicher Vertrauensakt verstanden wird, bleibt er auf Lehre bezogen. »Nicht zuletzt waren es Irrlehren, die die neutestamentliche Gemeinde zwangen, klipp und klar auf den Satz und auf den Punkt zu bringen, was christlicher Glaube ist und was er nicht ist. Glaube ist im Neuen Testament immer auch inhaltliches Bekenntnis, kein verschwommenes allgemeines Gottvertrauen.« Es braucht verbindliche und öffentliche Zeugnisse über das, was in Gemeinde und Mission gilt.
Gemeindebezogene Mission. Die ersten Missionsgesellschaften hatten eine den Kirchengemeinden dienende Funktion. Sie übernahmen Aufgaben, die einzelne Gemeinden allein nicht leisten konnten. Leider haben sich inzwischen viele Missionswerke von sendenden Gemeinden emanzipiert. Hinzu kommt, dass Gründung und Stärkung von Gemeinden oft nicht mehr im Zentrum stehen. Auch wenn nicht alle Missionsarbeit gemeindegebunden sein muss – ich denke hier beispielsweise an Studentenmission –, so sollte sie insgesamt dem Gemeindebau dienen.
Gemeinde ist Botschafterin, nicht die Botschaft. Bei der Mission verkündigen wir nicht uns selbst (2Kor 4,5) oder ersonnene Botschaften (vgl. 2Pt 1,16), sondern den für uns am Kreuz gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Verkündigung des Evangeliums ist treue »Ausbotschaftung« der Tatsache, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt hat, indem er seinen Sohn als Sühnopfer für uns Sünder hat sterben lassen, so dass diejenigen, die ihm vertrauen und umkehren, ewiges Leben haben.
Wenn zum Beispiel John Howard Yoder betont, dass die sichtbare Kirche nicht Überbringerin der christlichen Botschaft, sondern selbst die Botschaft ist, liegt hier eine Fehldeutung des Zeugendienstes zugrunde. Als Gesandte oder Zeugen des Evangeliums sind wir Überbringer einer Botschaft und nicht selbst Urheber oder Gegenstand dieser Botschaft (vgl. 2Kor 5,20, Apg 1,8).
Mittel der Mission ist die Predigt … »Stille Proklamation des Evangeliums ist« – wie D. A. Carson kürzlich gezeigt hat – »ein Oxymoron«, also ein begrifflicher Widerspruch. Das Evangelium begegnet Menschen, indem es verkündigt wird. Selbstverständlich soll die Verkündigung durch entsprechende Werke gedeckt und bestätigt werden. Doch die Werke gehören nicht selbst zum Evangelium, sondern sind Früchte des Evangeliums. Der Glaube kommt »aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort« (Röm 10,17). Insofern ist es vorrangige Aufgabe der Gemeinde, das Wort Christi zu verkündigen.
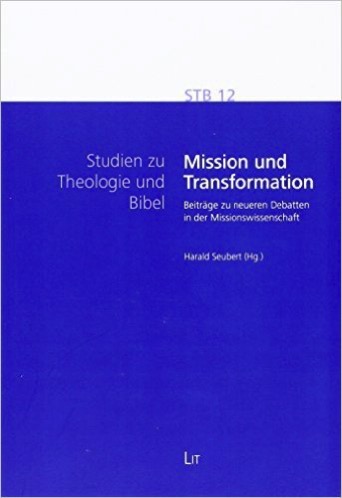 In den letzten Jahren hat die missionale Theologie weltweit für Aufsehen gesorgt. Ihre Vertreter leiten aus der Reich Gottes-Perspektive die kirchliche Verpflichtung ab, die Gesellschaft zu verändern, zum Beispiel, indem sie sich für den Umweltschutz oder „Soziale Gerechtigkeit“ einsetzen.
In den letzten Jahren hat die missionale Theologie weltweit für Aufsehen gesorgt. Ihre Vertreter leiten aus der Reich Gottes-Perspektive die kirchliche Verpflichtung ab, die Gesellschaft zu verändern, zum Beispiel, indem sie sich für den Umweltschutz oder „Soziale Gerechtigkeit“ einsetzen.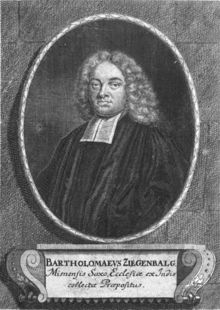 Vor vielen Jahren hatte ich das Vorrecht,
Vor vielen Jahren hatte ich das Vorrecht, 