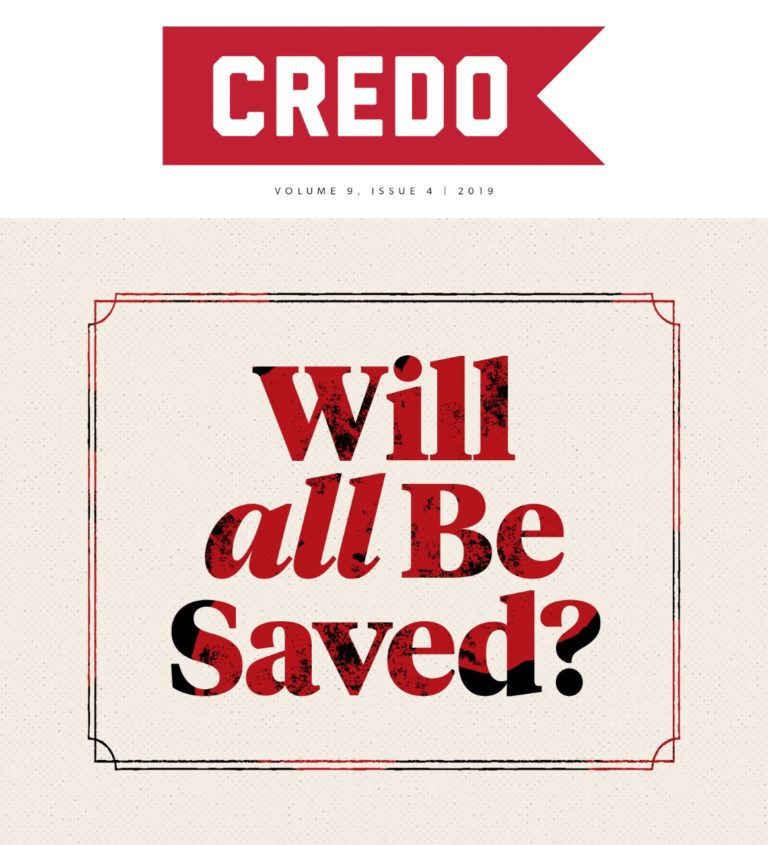 Werden alle Menschen gerettet? Es gibt nur wenige so sensible Fragen wie diese. Es ist so gut wie sicher, dass Antworten – wie immer sie ausfallen – emotionale Reaktionen hervorrufen. Für viele bedeutet die Antwort „nein“, den Charakter Gottes zu gefährden. Ein Gott, der nicht jeden rettet, kann nämlich kein Gott der Liebe sein. Als Reaktion darauf rütteln manchmal Evangelikale an Texten, die sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, oder an Texten, die die Lehre von der Hölle lehren, wobei sie immer den Kern der Sache vernachlässigen: eben den Charakter Gottes selbst.
Werden alle Menschen gerettet? Es gibt nur wenige so sensible Fragen wie diese. Es ist so gut wie sicher, dass Antworten – wie immer sie ausfallen – emotionale Reaktionen hervorrufen. Für viele bedeutet die Antwort „nein“, den Charakter Gottes zu gefährden. Ein Gott, der nicht jeden rettet, kann nämlich kein Gott der Liebe sein. Als Reaktion darauf rütteln manchmal Evangelikale an Texten, die sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, oder an Texten, die die Lehre von der Hölle lehren, wobei sie immer den Kern der Sache vernachlässigen: eben den Charakter Gottes selbst.
In Deutschland hat die These, Paulus sei ein Universalist gewesen, durch die Dissertation Paulus und die Versöhnung aller von Jens Adam (Tübingen, 2008, unter Hans-Joachim Eckstein und Hermann Lichtenberger) auftrieb erhalten. Für Adam ist „Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme“ (Röm 11,32) ein zentraler Vers zum Verständnis des – wie er meint – paulinischen Universalismus (Paulus und die Versöhnung aller 2009, S. 406):
Die Aussage von Röm 11,32 ist im Duktus des paulinischen Gedankengangs nicht nur innerhalb des Römerbriefs, sondern darüber hinaus als Zeugnis der paulinischen Christo-Logik insgesamt als prägnanter Beleg für den paulinischen Heilsuniversalismus zu begreifen. Dieser selbst stellt sich in höchst differenzierter wie reflektierter Weise dar. Das Heil des einzelnen Menschen wie des gesamten κόσμος liegt allein und ausschließlich in Jesus Christus beschlossen; eine wie auch immer begründete ‚Allversöhnung‘, die vom Bekenntnis zu diesem κύριος absehen möchte, ist eine paulinische Denk-Unmöglichkeit. Demzufolge geht der paulinische Heilsuniversalismus zwingend mit dem Signum des Glaubens an Jesus Christus einher, und remoto Christo hat der Mensch nichts als die gerechte Verurteilung vor dem Richterstuhl Gottes resp. Christi zu gewärtigen. Als Vater Jesu Christi bleibt Gott zugleich der Schöpfer, dessen Heilswillen in Jesus Christus von Ewigkeit her Bestand hat. Dem paulinischen Heilsuniversalismus nach fällt sich Gott selbst ins verurteilende Richterwort, begnadigt den zu Recht Verurteilten aufgrund seines umfassenden Erbarmens und spricht ihn also frei.
Die neue Ausgabe der Zeitschrift Credo hält viele interessante Artikel zum Thema bereit. Enthalten sind Beiträge von Archibald Alexander, Alan Gomes, Michael McClymond, Matthew Barrett, Glenn Butner, J. V. Fesko, Daniel Treier, Denny Burk, Joshua Greever, Todd Pruitt, Scott Smith und Matt Neidig.
Joshua Greever geht der Frage nach, ob Paulus ein Universalist war und schreibt zu Römer 11,32:
Auch die Interpretation von Römer 11,32 wird durch die Analyse des unmittelbaren literarischen Kontextes verdeutlicht. Dieser Vers schließt die heilsgeschichtliche Frage des Paulus in Römer 9–11 über die Erlösung Israels ab. Während es zahlreiche Meinungsverschiedenheiten über die genaue Identität „ganz Israels“ in 11,26 und den Begriff „Fülle“ (Römer 11,12,25) gibt, legt der Kontext nahe, dass es sich nicht um die Rettung eines jeden Menschen ohne Ausnahme, sondern um die Rettung von Volksgruppen handelt: Juden und Heiden.
Das deckt sich mit den Ausführungen von Eckhard J. Schnabel in seinem Kommentar zum Römerbrief (Der Brief des Paulus an die Römer, Bd. 2, 2016, S. 526–527):
Gott hat alle „dem Ungehorsam“ (εἰς ἀπείθειαν [eis apeitheian]) ausgeliefert bedeutet im Anschluss an das wiederholte παρέδωκεν [paredōken] von 1,24.26.28: Gott hat alle, nicht nur die Heiden, sondern auch die Juden, ihrem Ungehorsam und dessen Folgen überlassen, er hat sie „als Ungehorsame herausgestellt“. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Ungehorsams gegen Gott, in der „Gott die Abwendung der Menschen von ihm nicht bremst oder in ihrer Wirkung abmildert, sondern sich in all ihrer Destruktivität auswirken läßt“.378 Die Formulierung kombiniert Gottes souveränes Handeln, was den Ungehorsam von Juden und Heiden betrifft, mit der Verantwortung des einzelnen Juden und Heiden für seinen Ungehorsam. Dieselbe Gleichzeitigkeit von Gottes Souveränität und menschlicher Verantwortung haben wir in 1,18–3,20 bzw. 5,12–21 beobachtet. Das Ziel des Heilshandelns Gottes wird in V. 32b beschrieben: damit er sich aller erbarme (V. 32b). Mit „allen“ (πάντες [pantes]) sind Juden und Heiden gemeint, ohne dass der Gedanke der Allversöhnung (Apokatastasis) eingetragen werden darf.
Lietzmann spricht von der Ahnung eines tiefsten und beseligenden Geheimnisses, von der festen Zuversicht, „daß Gott alles zum Guten führen wird“, eine Zuversicht, die „siegreich“ durchbricht. Wilckens schreibt: „Es gibt keinerlei Ungehorsam, der nicht im Sühnetod Christi bereits aufgehoben ist, und der sich also auf Dauer und ewig dem Willen und der Kraft der Liebe Gottes entgegenstellen könnte“. Dunn spricht von der Transposition vom Ungehorsam in Moll zur Barmherzigkeit Gottes in Dur, in der sich Gottes Treue gegenüber Israel bewahrt und zur Vision der Versöhnung der ganzen Welt mit Gott am Ende führt, hält es dann aber doch für klüger, die summarische Beschreibung als lediglich allgemeine Aussagen zu interpretieren. Klein versteht Paulus im Sinn der „Rettung der ganzen Heidenwelt“. Hengel und Schwemer halten V. 32 für einen „der wichtigsten Sätze des ganzen Neuen Testaments“, der nach V. 26 festhält, dass mit dem Kommen des Messias am Ende der Weltgeschichte nicht nur ganz Israel durch Gottes Gnade gerettet wird, sondern dann auch „alle Völker im Zeichen des Evangeliums zu Gott zurückfinden, damit seine Gnade allein über alle Mächte des Bösen, Sünde, Tod und Teufel, triumphiere“, was im Blick auf die Erwartung des Paulus „durchaus realistisch-konkret“ zu verstehen sei. Flebbe sieht einen Hinweis auf „umfassendes und universales Heil für alle … ungeachtet der ethnischen Prägung“.
Paulus „will aufzeigen, welchen Sinn das widersprüchliche Geschick des Evangeliums bei Juden und Heiden im Plan Gottes haben könnte“. Weil Paulus in Röm 11 von Israel und den Völkern als kollektiven Größen spricht, meint πάντες in V. 32 nicht alle Menschen ohne Ausnahme, sondern „alle“ im Sinn von Juden und Heiden. Paulus spricht nicht nur in 1,18 vom Zorn Gottes, der etwa in 11,32 aufgehoben wäre, sondern auch in 12,19; in 13,2 ist vom Gericht Gottes, in 14,10 vom Richterstuhl Gottes die Rede. Die Unterscheidung zwischen individueller Erwählung (9,6–29) und kollektiver Erwählung (11,1.28–29), die Paulus im Blick auf Israel entfaltet, ist auch für V. 32b wichtig, in dem von Juden und von Heiden die Rede ist. Wie der individuelle Ungehorsam von Juden die kollektive Erwählung Israels nicht aufhebt, so hebt die kollektive Erwählung (Israel) bzw. Erschaffung (Heiden) die individuelle Verantwortung, die Heilsoffenbarung Gottes im Glauben anzunehmen, nicht auf. Die kollektive Erwählung Israels verschafft genauso wenig jedem einzelnen Israeliten/Juden Heil, ohne Rücksicht auf dessen Gehorsam oder Ungehorsam Gott gegenüber, wie die kollektive Erschaffung der Heiden durch Gott bedeutete, dass alle Polytheisten oder Atheisten, nur weil sie Geschöpfe Gottes sind, durch Gottes Gnade gerettet werden. Wie Gott innerhalb der kollektiven Erwählung Israels einzelne Individuen erwählt, denen er seine Gnade gewährt (9,6–29), so gewährt er innerhalb der Gesamtheit der von ihm geschaffenen Menschheit einzelnen Heiden seine Gnade. Die πάντες sind als solche zu bestimmen, „die in der Kraft der in Christi Tod und Auferstehung über sie gefallenen Entscheidung zum Glauben an ihren Erlöser kommen werden“.
Hier die aktuelle Ausgabe von Credo: credomag.com.
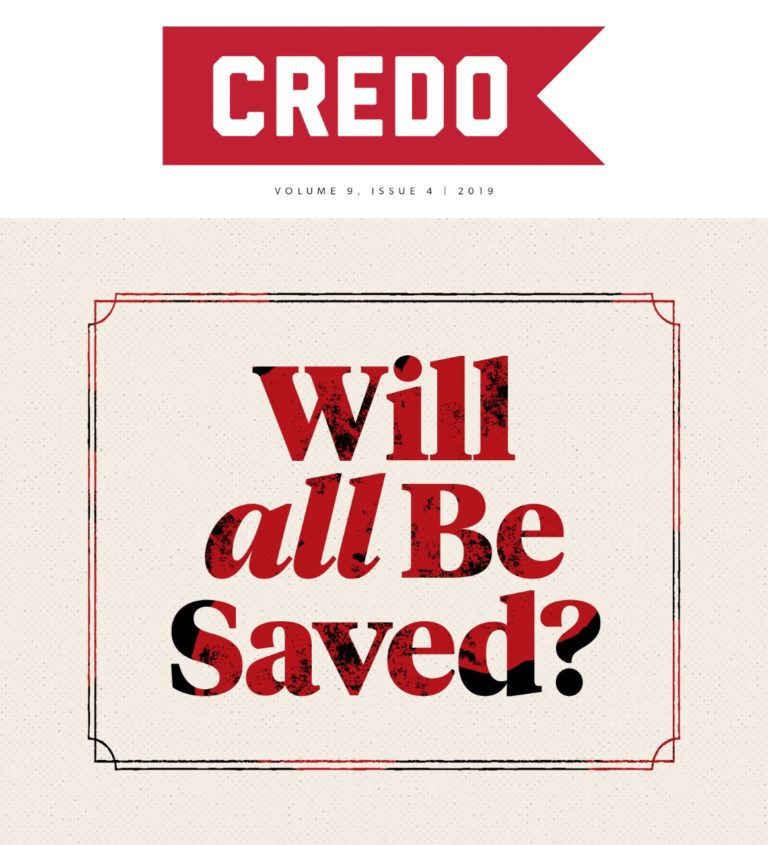 Werden alle Menschen gerettet? Es gibt nur wenige so sensible Fragen wie diese. Es ist so gut wie sicher, dass Antworten – wie immer sie ausfallen – emotionale Reaktionen hervorrufen. Für viele bedeutet die Antwort „nein“, den Charakter Gottes zu gefährden. Ein Gott, der nicht jeden rettet, kann nämlich kein Gott der Liebe sein. Als Reaktion darauf rütteln manchmal Evangelikale an Texten, die sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, oder an Texten, die die Lehre von der Hölle lehren, wobei sie immer den Kern der Sache vernachlässigen: eben den Charakter Gottes selbst.
Werden alle Menschen gerettet? Es gibt nur wenige so sensible Fragen wie diese. Es ist so gut wie sicher, dass Antworten – wie immer sie ausfallen – emotionale Reaktionen hervorrufen. Für viele bedeutet die Antwort „nein“, den Charakter Gottes zu gefährden. Ein Gott, der nicht jeden rettet, kann nämlich kein Gott der Liebe sein. Als Reaktion darauf rütteln manchmal Evangelikale an Texten, die sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, oder an Texten, die die Lehre von der Hölle lehren, wobei sie immer den Kern der Sache vernachlässigen: eben den Charakter Gottes selbst. D.A. Carson hat anlässlich der von Rob Bell angestoßenen Diskussion über den »Universalismus« auf der Gospel Coalition-Konferenz (12.–14. April in Chicago, USA) einen ungeplanten Vortrag mit dem Titel »God: Abounding in Love, Punishing the Guilty« gehalten. Carson stellt in dem Vortrag verschiedene Konzepte des Universalismus vor und zeigt auf, dass hinter den aktuellen Diskussionen Verschiebungen in der Gotteslehre stehen. Es geht nicht nur um den Universalismus, sondern auch um Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und das stellvertretende Sühneopfer von Jesus Christus.
D.A. Carson hat anlässlich der von Rob Bell angestoßenen Diskussion über den »Universalismus« auf der Gospel Coalition-Konferenz (12.–14. April in Chicago, USA) einen ungeplanten Vortrag mit dem Titel »God: Abounding in Love, Punishing the Guilty« gehalten. Carson stellt in dem Vortrag verschiedene Konzepte des Universalismus vor und zeigt auf, dass hinter den aktuellen Diskussionen Verschiebungen in der Gotteslehre stehen. Es geht nicht nur um den Universalismus, sondern auch um Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und das stellvertretende Sühneopfer von Jesus Christus.