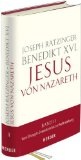 Morgen erscheint der zweite Teil des Jesusbuches von Benedikt XVI., das sich mit dem Leben von Jesus vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung auseinandersetzt. WELT online hat bereits einen Auszug abgedruckt, indem es über die Wahrheit heißt:
Morgen erscheint der zweite Teil des Jesusbuches von Benedikt XVI., das sich mit dem Leben von Jesus vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung auseinandersetzt. WELT online hat bereits einen Auszug abgedruckt, indem es über die Wahrheit heißt:
Was ist Wahrheit? Die skeptisch hingeworfene Frage des Pragmatikers Pilatus ist eine sehr ernste Frage, in der es in der Tat um das Geschick der Menschheit geht. Was also ist Wahrheit? Können wir sie erkennen? Kann sie als Maßstab in unser Denken und Wollen hereintreten, sowohl im Einzelnen wie im Leben der Gemeinschaft? Die klassische Wahrheitsdefinition der scholastischen Philosophie bezeichnet Wahrheit als »Entsprechung zwischen Verstehen und Wirklichkeit« (Thomas von Aquin). Wenn der Verstand eines Menschen eine Sache so widerspiegelt, wie sie in sich selber ist, dann hat der Mensch Wahrheit gefunden. Aber nur einen kleinen Ausschnitt aus dem, was wirklich ist – nicht die Wahrheit in ihrer Größe und als Ganzes. Schon näher kommen wir an die Intention Jesu mit einem anderen Wort des heiligen Thomas heran: »Die Wahrheit ist im Intellekt Gottes im eigentlichen Sinn und zuerst. Im menschlichen Intellekt aber ist sie eigentlich und abgeleitet.« So ergibt sich schließlich die lapidare Formel: Gott ist »die höchste und erste Wahrheit selbst«.
Mit dieser Formel sind wir in der Nähe dessen, was Jesus sagt, wenn er von der Wahrheit spricht, für die zu zeugen er in die Welt gekommen ist. In der Welt sind Wahrheit und Irrtum, Wahrheit und Lüge immer wieder fast untrennbar vermischt. Die Wahrheit in ihrer ganzen Größe und Reinheit erscheint nicht. »Für die Wahrheit Zeugnis geben« heißt darum, Gott und seinen Willen den Interessen der Welt und ihren Mächten gegenüber zur Geltung zu bringen. Gott ist der Maßstab des Seins. In diesem Sinn ist die Wahrheit der wirkliche »König«, der allen Dingen ihr Licht und ihre Größe gibt. – Denn sagen wir es ruhig: Die Unerlöstheit der Welt besteht eben in der Unlesbarkeit der Schöpfung, in der Unerkennbarkeit der Wahrheit, die dann zur Herrschaft des Pragmatischen zwingt und so die Macht der Starken zum Gott dieser Welt werden lässt.
An dieser Stelle ist man als moderner Mensch versucht zu sagen: Uns ist dank der Wissenschaft die Schöpfung lesbar geworden. In der Tat sagt beispielsweise Francis S. Collins, der das Human Genome Project leitete, mit freudigem Erstaunen: »Die Sprache Gottes war entschlüsselt.« Ja wirklich, in der großartigen Mathematik der Schöpfung, die wir im genetischen Code des Menschen heute lesen können, vernehmen wir die Sprache Gottes. Aber leider nicht die ganze Sprache. Die funktionelle Wahrheit über den Menschen ist sichtbar geworden. Aber die Wahrheit über ihn selbst – wer er ist, woher er kommt, was er soll und was das Gute ist oder das Böse –, die kann man leider auf solche Weise nicht lesen. Mit der wachsenden Erkenntnis der funktionellen Wahrheit scheint vielmehr eine zunehmende Erblindung für »die Wahrheit« selbst Hand in Hand zu gehen – für die Frage nach dem, was wir wirklich sind und was wir wirklich sollen.
Was ist Wahrheit? Diese Frage hat nicht nur Pilatus als unlösbar und für seine Aufgabe unpraktikabel beiseitegeschoben. Sie wird auch heute im politischen Disput wie im Disput um die Gestaltung des Rechts meist als störend empfunden. Aber ohne Wahrheit lebt der Mensch an sich selbst vorbei, überlässt er das Feld letztlich den Stärkeren. »Erlösung« im vollen Sinn kann nur darin bestehen, dass die Wahrheit erkennbar wird. Und sie wird erkennbar, wenn Gott erkennbar wird. Er wird erkennbar in Jesus Christus. In ihm ist Gott in die Welt hereingetreten und hat damit den Maßstab der Wahrheit inmitten der Geschichte aufgerichtet. Die Wahrheit ist äußerlich in der Welt ohnmächtig, wie Christus nach den Maßstäben der Welt ohnmächtig ist.
Ich möchte jetzt nicht ausführlich auf die thomistische Position zur »Wahrheit« eingehen (vgl. dazu hier). Insgesamt finde ich die Aussagen von Benedikt XVI. erstaunlich klar und mutig. Anstelle von: »Die Unerlöstheit der Welt besteht eben in der Unlesbarkeit der Schöpfung, in der Unerkennbarkeit der Wahrheit« würde ich jedoch unbedingt reformatorischer formulieren: Die Unerlöstheit der Welt zeigt sich darin, dass wir Menschen die Wahrheit nicht erkennen wollen, sie durch »Ungerechtigkeit niederhalten« (vgl. Röm 1,18). Ich bin gespannt, mehr aus dem Buch zu lesen.
Quelle: www.welt.de.
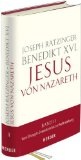 Morgen erscheint der zweite Teil des
Morgen erscheint der zweite Teil des