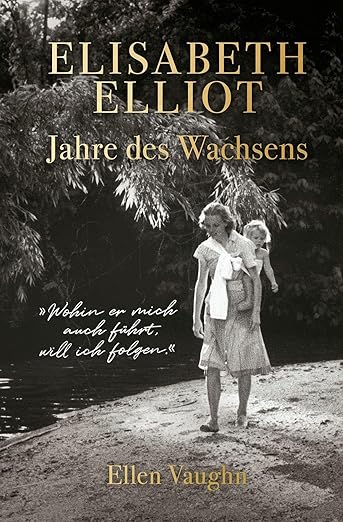Kehr das „Sie“ langsam zurück?
Jahrhundertelang wurden die Anredeformen respektvoller, doch seit sechzig Jahren breitet sich das „Du“ aus. Eine Wirkung der 68er-Generation. Jannis Koltermann erklärt die Entwicklung und sieht inzwischen ausgerechnet in Skandinavien Anzeichen für einen Gegentrend.
Hier ein Auszug (FAZ, 21.02.26, Nr. 44, S. 14):
In den Siebzigerjahren sorgte der Soziologe Richard Sennett mit dem Schlagwort „Tyrannei der Intimität“ für Aufsehen. Die Gegenwart, beklagte er, habe Nähe zu einem moralischen Wert an sich erhoben und den Mythos etabliert, dass sich „sämtliche Missstände der Gesellschaft auf deren Anonymität, Entfremdung, Kälte zurückführen“ ließen.
Die Ausbreitung des Duzens hatte Sennett damals nicht gemeint – vielleicht, weil er sich vorrangig im englischen Sprachraum bewegte, vielleicht, weil sie damals gerade erst eingesetzt hatte. Doch fühlt sich unweigerlich an Sennett erinnert, wer heute an einem gewöhnlichen Tag in Deutschland darauf achtet, wie er von wem angesprochen wird. „Was möchtest du trinken?“, fragt der Kellner im Café. Auf der Arbeit eine E-Mail von der Chefin: „Würdest du das bis heute Abend schaffen?“ Der Energieanbieter teilt mit: „Deine Rechnung ist online.“ Und das Museum verspricht: „Du bist Teil der Geschichte!“
In all diesen Situationen wäre vor sechzig und vermutlich noch vor zwanzig Jahren das Sie üblich gewesen. In all diesen Situationen wird einem das Du heute geradezu aufgedrängt. Servicekräfte und Unternehmen scheinen gar nicht daran zu denken, dass man vielleicht lieber gesiezt werden möchte – und wer lehnt schon das Duz-Angebot seines Vorgesetzten ab? Während man früher im Zweifel auf das Sie setzte, gilt gerade das heute in vielen Situationen als deplatziert. Siezen auf Twitter sei „unhöflich“, befand der Youtuber Rezo einmal.
Historisch ist diese Entwicklung nahezu einmalig. Über Jahrhunderte hinweg wurden die Anredeformen immer respektvoller. Ursprünglich gab es im Deutschen nur das Du, ehe sich im Hochmittelalter das Ihr als höflichere Anrede für und unter Adeligen herausbildete. Um 1600 kam das Er/Sie (dritte Person Singular), um 1700 das Sie (dritte Person Plural) als jeweils noch ehrerbietigere Formen hinzu, sodass im 18. Jahrhundert ganze vier Anredeformen nebeneinanderstanden, mit denen sich gesellschaftliche Rangunterschiede präzise benennen ließen. Dann erfolgte eine Angleichung nach oben: Ihr und Er gerieten allmählich in Vergessenheit, weil das aufstrebende Bürgertum nun ebenfalls das Sie als höchste Höflichkeitsform für sich in Anspruch nahm.