Dramatisieren die Medien Schwangerschaftskonflikte?
Ich finde es erschreckend, wie unkritisch die FAZ Ansichten von Abtreibungsbefürtwortern propagiert und infolgedessen auch noch groben Unfug verbreitet. In dem Interview „Frau allein, traurig, depressiv“ darf die Filmemacherin Franzis Kabisch darlegen, wie es Abtreibungsgegner gelungen ist, mittels Fotos und bildgebender Verfahren die Kritik an Schwangerschaftsabbrüchen zu untermauern. Den Interviewer Matthias Dell, (schreibt auch für ZEIT, SPIEGEL und DEUTSCHLANDRADIO) scheint es zu erfreuen, wenn über die spielerische Leichtigkeit bei der seelischen Verarbeitung von Abtreibungen berichtet wird.
Konkret: Kabisch behauptet:
Mit der Personalisierung des Fötus. Viele Forscherinnen markieren das als einen wichtigen Punkt. Der Fötus wurde instrumentalisiert von rechten Gruppen – als eigene Person, die, wie die Historikerin Barbara Duden das nennt, zum „öffentlichen Fötus“ wurde. Der braucht nichts, sondern ist autonom und universal. Diese völlige Loslösung von der Schwangeren hat es einfach gemacht, sich für den Fötus einzusetzen. Der wird dagegen auch nie Widerstand leisten und so vereinnahmt für einen „Lebensdiskurs“, in dem die schwangere Person ihm entgegengesetzt ist als Bedrohung. Dabei ist niemand automatisch ein autonomer Mensch, auch das Baby braucht nach der Geburt Fürsorge, Nahrung.
Was passiert hier: Menschen, die davon überzeugt sind, dass auch ein ungeborenes Kind Person ist, werden in die rechte Ecke gestellt. Zugleich wird die These aufgestellt, dass diese Leute meinten, ein Fötus sei autonom und könne von einer schwangeren Frau völlig losgelöst betrachtet werden. Beide Behauptungen sind falsch.
Erwartbar wird in dem gesamten Interview auf das Forschungslage zur Situation der Frauen gar nicht eingegangen. Vermittelt werden soll: Die allermeisten Frauen sind glücklich mit ihrer Entscheidung, abgetrieben zu haben. Was über die Medien – insbesondere durch Bilder – vermittelt wird, dass nämlich Föten Personen seien und Frauen, die abgetrieben haben, Selbstzweifel hätten, ist nur konstruierte Wirklichkeit.
Dass der STERN 1971 mit seine Kampanie „Ich habe abgetrieben“ Frauen bewusst „in Szene gesetzt“ hat, wird nicht einmal erwähnt. Im Gegenteil! Kabisch behauptet: „Es stehen sogar die Namen darunter. Und die Frauen sehen eigentlich alle zufrieden aus, erleichtert oder einfach so, wie man sich Menschen im Alltag vorstellt, die nicht für ihr Leben traumatisiert sind.“
Haben die Kulturwissenschaftlerin Franzis Kabisch und der Medienjournalist Matthias Dell übersehen, dass es ein großer Bluff war, als Romy Schneider, Senta Berger und Alice Schwarzer zusammen mit 371 anderen Frauen im Stern bekannten „Wir haben abgetrieben!“? Alice Schwarzer hat zum Beispiel schlicht gelogen: „Aber das spielte keine Rolle. Wir hätten es getan, wenn wir ungewollt schwanger gewesen wären“ (vgl. hier).
Wenden wir uns kurz von der medialen Wirklichkeit ab. Die Ärztin Angelika Pokropp-Hippen zitiert in ihrem Aufsatz über das Post Abortion Syndrom (PAS) aus einer Studie des Elliot Institutes, bei der 260 Frauen von 15 bis 35 Jahren aus 35 verschiedenen Staaten der USA zu ihrem Gefühlszustand nach der Abtreibung befragt wurden:
- 92,60% der befragten Frauen leiden an starken Schuldgefühlen
- 88,20 % leiden an Depressionen
- 82,30 % haben ihr Selbstwertgefühl verloren
- 55,80% haben Selbstmordgedanken
- 66% beendeten die Beziehung zu ihrem Sexualpartner nach der Abtreibung
- 40,60% begannen, Drogen zu nehmen
- 36,50% flüchteten in den Alkohol
Johannes Gonser setzt sich in seinem Buch Abtreibung – ein Menschenrecht?: Argumentationshilfen zur Debatte um den Schwangerschaftsabbruch übrigens gründlich mit der Frage auseinander, ob ein ungeborener Mensch Person ist oder nicht. Das Buch ist meiner Meinung nach ein wichtiger Debattenbeitrag.
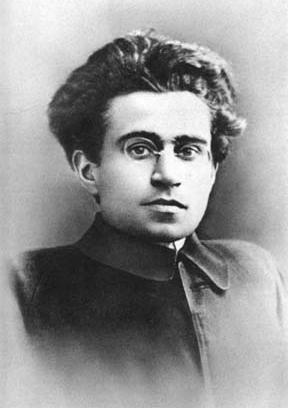 Der Grünen-Politiker Volker Beck sagte einmal über seine Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter (Das Parlament, 06.04.2009, S. 6):
Der Grünen-Politiker Volker Beck sagte einmal über seine Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter (Das Parlament, 06.04.2009, S. 6):