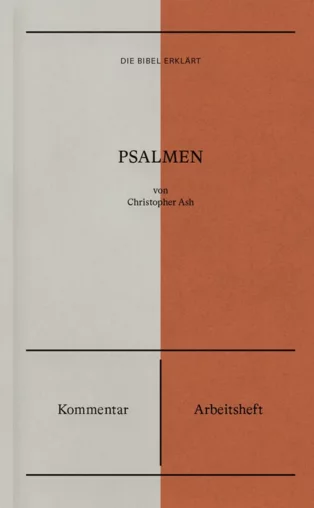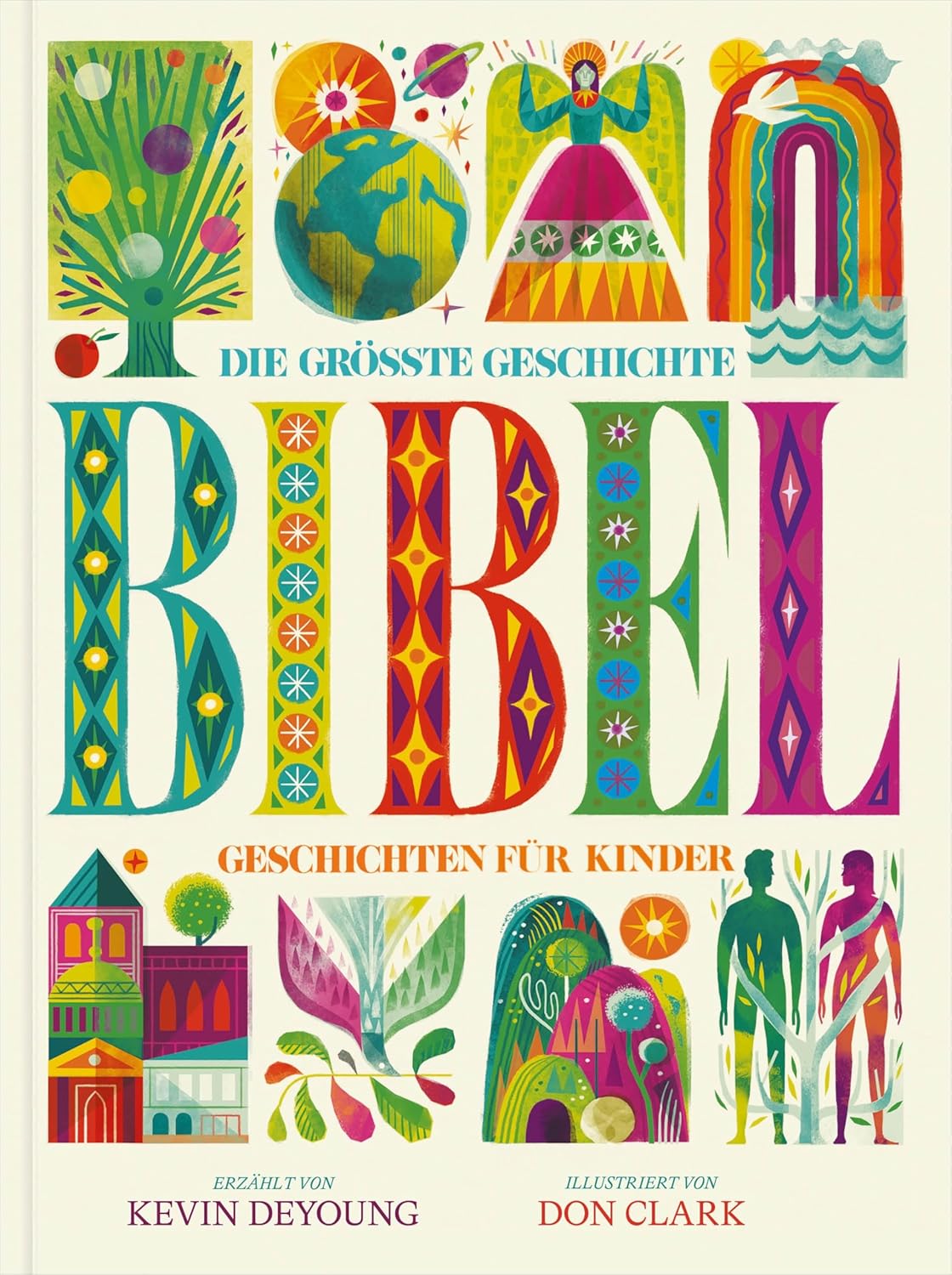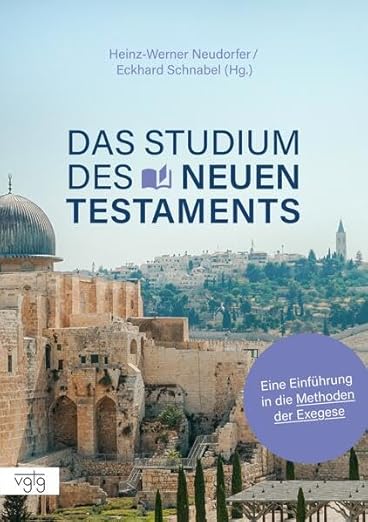Wer die Woke-Kultur besser verstehen möchte, dem sei das Buch Woke – Psychologie eines Kulturkampfes von Esther Bockwyt empfohlen. Esther Bockwyt studierte Psychologie und Rechtspsychologie an den Universitäten Marburg, Köln und Bonn. Sie arbeitet als freiberufliche psychologische Gutachterin. Nebenbei analysiert sie gesellschaftliche Entwicklungen und hat meines Erachtens die Grundannahmen und -anliegen der Woke-Bewegung sehr gut erfasst und verständlich dargestellt.
Hier ein Auszug (Woke, 2024, S. 15–17):
Die Ursprünge der heutigen Wokeness sind in der Philosophie der Postmoderne der 60er-Jahre zu finden, beispielsweise bei Michel Foucault4 , wobei manch einer beklagt, dass jener und andere für die heutigen woken identitätspolitischen Auswüchse zu Unrecht herhalten müssen. Jedenfalls stammt aus dieser philosophischen Strömung die Annahme, dass alles menschliches Streben auf Macht ausgerichtet sei. Wissen, Sprache und gesellschaftliche Ordnungen seien letztlich immer und ausschließlich Ausdruck von Machtverhältnissen und eine objektive Wahrheit werde von diesen Verhältnissen untergraben: der Ursprung woker Ideologie.
Diese postmoderne Philosophie ist dabei ein Gegenentwurf zur Moderne und ihrer Philosophie der Aufklärung, auf der westliche Demokratien seit ungefähr 200 Jahren fußen. Die Moderne ist von der Philosophie des Liberalismus geprägt und in diesem Sinne fußen westliche Demokratien auf den Werten des Individualismus, also darauf, der Freiheit des Individuums Priorität einzuräumen, sie als Grundlage zu bestimmen. Darauf, dass das Individuum nach seinem Glück und der Erfüllung seines Lebens strebt. Der Mensch als Individuum ist Träger von Rechten, Pflichten und Verantwortung. Bereits in der Antike angelegt, entfaltete der Individualismus später in Europa seit der Renaissance seine Kraft, forciert durch humanistische, aufklärerische Bewegungen. Europäische Philosophen entwickelten die geistigen Fundamente, auf welchen die heutigen liberalen europäischen Gesellschaften fußen und sich im deutschen Grundgesetz wie in der amerikanischen Verfassung in der unveräußerlichen Würde des Menschen deutlich formuliert wiederfinden.
Kollektivistische Ideologien wie der Nationalsozialismus oder der Kommunismus zerstörten die liberal-demokratischen Rechtsstaaten zwischenzeitlich, indem sie einem Volk oder einer Klasse Vorrang vor dem Individuum gaben, »Gemeinnutz vor Eigennutz« predigten und hiermit den Grundstein für menschenverachtende und inhumane (Kultur-)Praktiken legten.
Der Mensch ist in der Philosophie und gelebten Demokratie der Moderne Individuum und hat zugleich Anteil am Universellen, am allgemeinen Menschsein, das alle Menschen gleichermaßen teilen. Alle Menschen sind trotz aller individuellen Unterschiede als Menschen in ihrem Menschsein gleich und gleichberechtigt. Freiheit, Gleichheit der Chancen, aber auch die aufklärerischen Werte der Vernunft und die wissenschaftliche Methode, die Rechtsstaatlichkeit mit Machtbegrenzung durch das Recht mit seiner Gewaltenteilung und die freie Marktwirtschaft sind die Grundpfeiler westlicher – auf der Philosophie der Moderne – fußender Demokratien. Die postmodernen Entwicklungen hingegen brechen mit einigen dieser Werte. Grundlegend in dieser Philosophie sind die Annahmen von Relativismus und Sozialkonstruktivismus, also die Annahmen, dass Realität immer auch anders erzählt werden könne und dass Realität sozial konstruiert wird. Und zwar dadurch, wie Menschen sozial miteinander interagieren, und über die Geschichten, die Menschen über die Wirklichkeit erzählten. Diese Geschichten bilden ein jeweiliges Narrativ und seien allein durch existierende Machtverhältnisse bestimmt. Alles sei nur eine Erzählung, die mit anderen Erzählungen, also Sichtweisen, konkurriere. Zwei mal zwei muss nicht vier sein, es kann auch, je nach Umständen, fünf oder irgendetwas anderes sein.
[#ad]