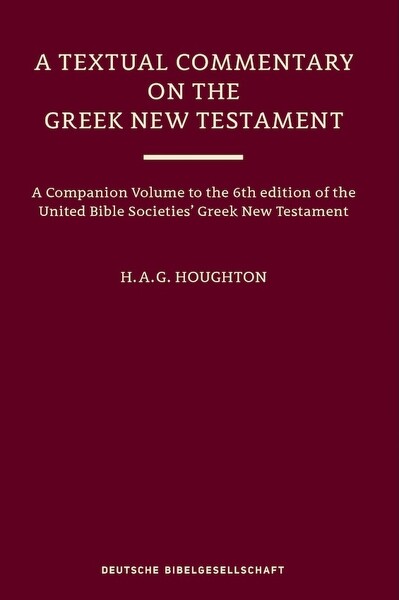Der griechische Begriff μονογενής [monogenēs] hat es in sich. Das NT gebraucht dieses Wort zum Beispiel in Joh 3,16, wo fast alle deutschsprachigen Übersetzungen schreiben: „einzigen Sohn“. Auch die neueste Revision der English Standard Version (ESV) hat sich für „only Son“ entschieden.
Luther 2017 übersetzt anders, nämlich: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Hier steht Luther 2017 in Kontinuität zum nizänischen Glaubensbekenntnis (325 n. Chr.), das in der deutschen Übertragen das τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ [ton Hyion tou Theou ton monogenē] mit „den eingeborenen Sohn Gottes“ wiedergibt.
Charles Lee Irons hat am 9. Mai einen lesenswerten Debattenbeitrag zur Übersetzung von μονογενής [monogenēs] veröffentlicht. Darin heißt es:
In den letzten Jahren hat es eine Debatte darüber gegeben, wie das griechische Wort μονογενής im Neuen Testament am besten zu übersetzen ist. Dieses Wort kommt im griechischen Neuen Testament neunmal vor – fünfmal in christologischen Kontexten (alle in der johanneischen Literatur: Joh 1,14.18; 3,16.18; 1 Joh 4,9) und viermal in nicht-christologischen Kontexten (Lk 7,12; 8,42; 9,38; Hebr 11,17). In den nicht-christlichen Kontexten bezieht es sich auf ein gewöhnliches „einziges Kind“ oder einen „einzigen Sohn“ und beinhaltet nicht notwendigerweise eine Vorstellung wie den Akt des Vaters, ein Kind zu zeugen oder ein Kind zu zeugen. In Lukas 9,38 lesen wir zum Beispiel, dass ein Mann aus der Menge Jesus zurief: „Lehrer, ich bitte dich, sieh dir meinen Sohn an, denn er ist mein einziges Kind“. Es wäre durchaus vernünftig, μονογενής in diesen nicht-christologischen Fällen als „einziger Sohn“ oder „einziges Kind“ wiederzugeben (wie es die ESV und NIV tun), und es gibt keinen zwingenden kontextuellen Grund, hier das schwerfällige Wort „gezeugt“ zu verwenden.
Die christologische Verwendung des Wortes im Evangelium und im Ersten Johannesbrief ist jedoch umstritten. Das bekannteste Beispiel ist Johannes 3,16, das viele von uns nach der King James Version im Gedächtnis haben: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ Hier haben wir eine lebhaftere Debatte. Bei der christologischen Verwendung des Wortes steht viel mehr auf dem Spiel, denn jetzt kommen wir in den Bereich der Christologie und der trinitarischen Theologie.
In dieser Debatte zeichnen sich drei Hauptansätze ab. Der erste Ansatz besteht darin, der traditionellen Übersetzung von William Tyndale und der King James Version zu folgen und zumindest in den fünf johanneischen Begebenheiten die Wiedergabe „eingeboren“ anzunehmen. Zugegebenermaßen ist diese Übersetzung eine gewisse Herausforderung für moderne Leser, für die das Wort „gezeugt“ archaisch ist und keine klare Bedeutung hat. Aber sie hat den Vorteil, dass sie mit dem nizänischen Glauben und der historischen Tyndale-King James-Tradition der englischen Bibel übereinstimmt. Nur eine Handvoll moderner Gelehrter verteidigt „only begotten“.
Der zweite Ansatz behauptet, dass μονογενής „einzigartig“ bedeutet. Die Befürworter dieses Ansatzes lehnen die traditionelle Wiedergabe als einen Fall von kirchlichem Dogma ab, das in ein griechisches Wort hineingelesen wird. Soweit ich weiß, war B. F. Westcott einer der ersten Gelehrten, der den Begriff „eingeboren“ in der johanneischen Literatur in seinen Kommentaren zum Johannesevangelium und den Johannesbriefen in Frage stellte. Seinem Ansatz folgten Ferdinand Kattenbusch, Moulton und Milligan, Francis Marion Warden, Dale Moody, Joseph Fitzmyer und viele andere. Es war die Mehrheitsmeinung unter evangelikalen Bibelwissenschaftlern während des gesamten zwanzigsten Jahrhunderts und ist es bis heute. Ich nenne diese Ansicht die „revisionistische“ Ansicht.
Eine dritte Möglichkeit, die sich in letzter Zeit herausgebildet hat, besteht darin, meiner Kritik an „einzigartig“ zuzustimmen, aber nicht davon überzeugt zu sein, dass „eingeboren“ richtig ist. Diejenigen, die sich für die dritte Option entscheiden, stimmen mit meiner Kritik an den Revisionisten überein, d. h. sie stimmen zu, dass μονογενής im Neuen Testament (sowohl in den christologischen als auch in den nicht-christologischen Passagen) nicht „einzigartig“ bedeutet. Der Grund dafür ist, dass das Neue Testament das Wort nur in familiären Kontexten verwendet, in Bezug auf einen menschlichen Vater, der einen einzigen Sohn hat. In den christologischen Zusammenhängen, in Analogie zu einem menschlichen Vater, der einen einzigen Sohn hat, hat auch Gott „seinen einzigen Sohn“. Die Befürworter der dritten Option argumentieren jedoch, dass es zu weit ginge, den dogmatischen Begriff „gezeugt“ einzufügen. Diese Gelehrten schlagen vor, dass wir einfach dem nicht-christlichen Sprachgebrauch im Lukasevangelium folgen und die Formulierung „einziger Sohn“ annehmen sollten. Damit wird zwar die dem Wort innewohnende Idee der Sohnschaft erfasst, nicht aber die Idee der Zeugung. Dieser weitere Gedanke der Zeugung stammt aus der lateinischen Übersetzung unigenitus, nicht aus dem griechischen Wort μονογενής, das einfach „einziges Kind, d. h. ohne Geschwister“ bedeutet. Dieser Ansatz wird von Dr. Seumas MacDonald vertreten, einem Griechischlehrer und Patristik-Experten, der wissenschaftliche Artikel im Blog The Patrologist verfasst. Es scheint auch der Ansatz zu sein, den das ESV Translation Oversight Committee kürzlich in der Aktualisierung 2025 verfolgt hat.
Mehr hier: bulletin.kenwoodinstitute.org.