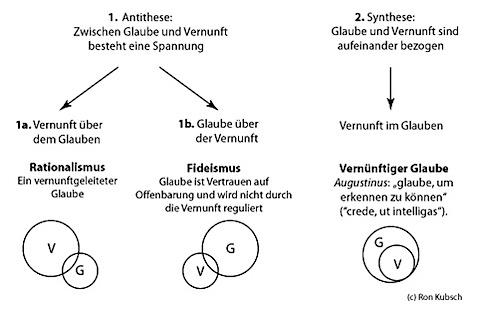Augustinus: Lehrer der Gnade (Teil 5)
Augustinus führt in seinem Brief 194 (S. 349–351) weiter aus, dass Gott Gebete wirklich erhört, aber auch das Gebet des Glaubens nicht etwas ist, was wir Menschen unserem eigenen Vermögen zuschreiben sollten. Der Glaube kommt aus der Predigt des Evangeliums. Obwohl viele das Wort hören, glauben nicht alle. Gottes Ratschluss und seine Gerichte sind unausforschlich, aber Gott ist deshalb nicht ungerecht.
Im nächsten Abschnitt (S. 351–353) betont Augustinus, dass alles Gute Gnadengeschenk ist.
Augustinus: Alles Gute haben wir empfangen
Der Glaube also zieht uns zu Christus. Würde er uns nicht als ein unverdientes Geschenk verliehen, so würde nicht Christus selbst sprechen: »Niemand kommt zu mir, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht« (Joh 6,44). Darum spricht er gleich darauf: »Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben« (Joh 6,64–65) Sodann fügt der Evangelist bei: »Denn Jesus wußte von Anfang an, wer die Glaubenden seien und wer ihn verraten würde«. Und damit niemand meine, die Glaubenden ständen in einer solchen Beziehung zu seinem Vorauswissen, wie die Nichtglaubenden, das heifjt, es würde ihnen der Glaube nicht von oben verliehen, sondern nur ihr Wille im voraus erkannt, fügt er zugleich bei: »Und er sprach: ›Deshalb habe ich euch gesagt, daß niemand zu mir kommt, wenn es ihm nicht von meinem Vater gegeben ist‹« (Joh 6,66). Daher kam es, daß einige von denen, die seine Rede über sein Fleisch und Blut gehört hatten, geärgert davongingen, einige aber glaubend dablieben, weil niemand zu ihm kommen kann, wenn es ihm nicht vom Vater und folglich auch vom Sohne und dem Heiligen Geiste gegeben ist. Denn die Gaben und Werke der unteilbaren Dreieinigkeit sind nicht getrennt. Indem aber der Sohn den Vater auf solche Weise ehrt, liefert er nicht den Beweis, daß irgendeine Verschiedenheit obwaltet, sondern gibt ein großes Beispiel der Demut.
…
Denn wenn wir sagen, der Glaube sei vorausgegangen und in ihm liege, was die Gnade verdient, welches Verdienst hatte dann der Mensch vor dem Glauben, wodurch empfing er ihn? Denn was hat er, das er nicht empfangen hätte? Hat er es aber empfangen, was rühmt er sich, gleich als hätte er es nicht empfangen? Denn wie er Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit, Gottesfurcht nicht hätte, wenn er nicht nach dem Ausspruche des Propheten den Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Stärke, der Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht empfangen hätte – wie er weiter Tugend, Liebe, Enthalt¬samkeit nicht hätte, wenn er nicht den Geist empfangen hätte, von dem der Apostel schreibt: »Denn ihr habt nicht empfangen den Geist der Furcht, sondern den Geist der Tugend, der Liebe und der Selbstbeherrschung» (2Tim 1,7), so hätte auch niemand den Glauben, wenn er nicht den Geist des Glaubens empfangen hätte, von dem derselbe Apostel sagt: »Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht: ›Ich glaubte, darum redete ich‹, so glauben auch wir, und darum reden wir« (2Kor 4,13). Daß wir ihn aber nicht durch ein Verdienst erlangt haben, sondern durch die Barmherzigkeit dessen, der sich »erbarmt, wessen er will«, zeigt er ganz deutlich, wenn er von sich selbst sagt: »Ich habe die Gnade erlangt, treu zu sein« (1Kor 7,25).
 Mit gutem Recht wird die Bronzetür am Hauptportal des Großmünsters in Zürich Bibeltür genannt, besteht sie doch aus 42 aneinandergefügten, quadratischen Kassetten, die entweder Worte aus der Bibel enthalten oder aber biblische Geschichten bzw. Personen zum Inhalt haben.
Mit gutem Recht wird die Bronzetür am Hauptportal des Großmünsters in Zürich Bibeltür genannt, besteht sie doch aus 42 aneinandergefügten, quadratischen Kassetten, die entweder Worte aus der Bibel enthalten oder aber biblische Geschichten bzw. Personen zum Inhalt haben.