Kant und die Theologie (Teil 2)
Im Oktober 2012 kam es in der chilenischen Presse zu einem Schlagabtausch zwischen dem Kantianer Pfarrer Richard Wagner und dem Philosophieprofessor Daniel von Wachter. Ich geben den Disput in zwei Teilen mit freundlicher Genehmigung wieder. Hier die Replik von Daniel von Wachter auf den Beitrag von Richard Wagner:
Die Anti-Vernünftigkeit Kants und die Umdeutung des Gottesbegriffs
Daniel von Wachter
Herr Wagner trägt in diesem Artikel eine Lehre Immanuel Kants und die Auffassung vor, man könne durch das Universum keine Erkenntnis über Gott gewinnen. Das folgende ist eine Gegendarstellung.
Aufklärung
Herr Wagner stellt seine Position als die „aufgeklärte“ dar, welche bedauerlicher- und seltsamerweise „immer noch“ nicht alle angenommen hätten, was entweder ein Mangel an Kenntnis dieser Position oder ein Mangel an Vernunft sein müsse. Das ist die Rhetorik derjenigen Bewegung des 18. und 19. Jahrhunderts, die sich in aller Bescheidenheit „Die Aufklärung“ und ihre Gegner als die Abergläubischen, Unvernünftigen und Dogmatischen dargestellt haben. Es ist normal zu glauben, daß man selbst recht hat und die anderen irren – das liegt in der Natur einer Überzeugung. Aber die bloße Behauptung, die Vernunft gepachtet zu haben, sollte keinen vernünftigen Menschen überzeugen. Es kommt auf die Argumente, die Begründungen an, und bei jenen Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts sind die Begründungen ebenso dünn wie die Behauptungen der eigenen Aufgeklärtheit laut. Die Rhetorik des Man-kann-heute-nicht-mehr-X-glauben oder des Wir-haben-das-Mittelalter-überwunden will, ohne sich die Mühe des Begründens zu machen, den Eindruck erwecken und darauf hinwirken, daß der Glaube an den Schöpfergott, an Wunder, an die Existenz der Seele, an die Willensfreiheit und an objektive Moral aussterben werde. Doch das werden sie ebensowenig wie die materialistischen Gegenpositionen aussterben werden. Es bleibt die Aufgabe eines jeden Menschen, nach der Wahrheit zu suchen.
Immanuel Kant
Herr Wagner glaubt an die Lehren Immanuel Kants und meint zudem, diese müßten jeden Vernünftigen überzeugen. Dazu muß sich jeder selbst ein Urteil bilden. Doch es ist keineswegs so, wie Theologen manchmal meinen, daß man „seit Kant“ dieses oder jenes nicht mehr glauben könne. Es kommt in der Philosophie selten oder nie vor, daß eine Position unhaltbar wird und ausstirbt. Das liegt wohl nicht zuletzt daran, daß in der Philosophie auch starke irrationale Beweggründe wirken.
Zur Auflockerung sei meine Einschätzung Kants genannt, mit der ich nicht allein stehe, und wenn ich es täte, wäre sie deshalb noch lange nicht falsch: Kant litt unter einem neurotischen Sicherheitsbedürfnis. Er wollte keine Metaphysik dulden, welche Gründe und Wahrscheinlichkeiten abwägt. „Ich verbitte mir das Spielwerk von Wahrscheinlichkeit und Mutmaßung“, schrieb er. In der Metaphysik dürfe es um nichts weniger denn „apodiktische Gewißheit“ gehen. Die Existenz von vom Menschen unabhängigen Gegenständen war ihm deshalb unerträglich. Daher machte er seine pubertäre „kopernikanische Wende“ und sagte, nicht unser Denken richte sich nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände richten sich nach unserem Denken. Wir erschaffen die Gegenstände. Das ist ein Musterbeispiel von Irrationalität, denn der vernünftige Mensch hält seine Wahrnehmungserlebnisse, seine Eindrücke weder für unfehlbar, noch verwirft er sie völlig, geschweige denn, daß er glaubt, die Gegenstände hingen von ihm ab. Passend zu seiner Irrationalität hat Kant in die deutsche Philosophie den dunklen, unklaren Stil eingeführt, der manchen zwar beeindruckt, aber das wissenschaftliche Niveau senkt.
Können wir durch das Universum Erkenntnis über Gott gewinnen?
Herr Wagner nennt die Überlegungen über Gott als Ursache des Universums „rührend-naiv“. In wenigen Zeilen will er – an entsprechende Behauptungen im Werke Kants angelehnt – zeigen, daß gleichermaßen schlüssige Gedankengänge über die letzte Ursache zu widersprüchlichen Ergebnissen führen. Das soll zeigen, daß wir durch solches Denken keine Erkenntnis über Gott gewinnen können.
Doch wie schon unzählige Kritiker Kants dargelegt haben, sind die genannten Gedankengänge keineswegs schlüssig. Kaum ein Philosoph sagt, alles müsse eine Ursache haben. Die Frage ist, ob das Universum eine Ursache hat, nämlich Gott. Entweder das Universum (in seiner gesamten zeitlichen Ausdehnung) oder Gott hat keine Ursache. Die Diskussion über diese Themen ist heute ausführlicher und gründlicher denn je. Da gibt es viele Positionen, aber wenn man da in seiner Position einen Widerspruch hat, muß man halt etwas an der Position ändern. Unvermeidliche Widersprüche gibt es da keine.
Herr Wagner trägt die Kantische These vor, Kausalität sei nichts in der Welt, sondern eine Weise, wie wir unsere Erfahrungen ordnen. Das glaube wer will, doch fragen Sie sich bitte, was vernünftiger ist: zu glauben, daß es eine unabhängig von unserem Denken bestehende Tatsache ist, daß das Erdbeben das Herunterfallen der Autobahnbrücke des Vespucio Norte verursacht habe, oder daß diese Verursachung nur etwas in unserem Kopf sei. Um Kants Lehren zu beurteilen muß man so direkt und einfach fragen: Ist es vernünftig, das zu glauben? Hier kommt der im Titel von Wagners Artikel genannte Kaiser ins Spiel: die Frage ist, ob der Kaiser nackt und Kant und die Kantianer unvernünftig sind.
Der Schöpfer
Herr Wagner will – Autoren wie Schleiermacher und Bultmann folgend – die Aussage „Gott ist der Schöpfer des Universums“ uminterpretieren in eine Aussage über Wert, Sinn oder Gefühl. Er behauptet wohl, daß sie nichts über eine Ursache des Universums sage, daß sie sich durch keine Beobachtungen des Universums belegen lasse. Damit wendet er sich gegen alle Überlegungen dazu, daß die Lebewesen, unser Körper oder andere Aspekte des Universums Hinweise auf Gott gäben. Doch zu sagen, die Aussage „Gott ist der Schöpfer des Universums“ sei eine Aussage nur über Sinn und Gefühl, ist so absurd und verwirrend wie zu sagen, die Aussage „Die Ampel ist rot“ bedeute in Wirklichkeit: „Ich will nicht mehr weiterfahren.“ Es ist offensichtlich falsch, d.h. es widerspricht den normalen Regeln der Sprache. Nach den normalen Regeln der Sprache bedeutet „Gott ist der Schöpfer des Universums“ das, was der normale Nicht-Theologe darunter versteht: Daß Gott das Universum erschaffen hat und es erhält. Theologen machen seit zwei Jahrhunderten diese Sinnveränderungsverrenkungen, weil sie nicht direkt und klar sagen wollen, was sie meinen, z.B. daß es nicht wahr sei, daß Gott der Schöpfer des Universums sei.
Die Frage ist, ob es einen Gott gibt. Wenn es ihn gibt, ist er der Schöpfer und Erhalter des Universums. Christliche Philosophen haben seit eh und je gründlich und auf dem jeweiligen Stand der Naturwissenschaft dargelegt, daß vieles im Universum, etwa der Menschliche Körper oder der Urknall für die Existenz Gottes spricht. Es sind Indizien für die Existenz Gottes. Das heißt, daß die Annahme der Existenz Gottes diese Dinge erklärt und es weniger wahrscheinlich ist, daß sie von niemandem geschaffen wurden.
Wagners Aussage, wir hätten „keine allgemein überzeugende philosophische Metaphysik“ und Kant habe die vergangene Metaphysik „zertrümmert“ ist, läßt Kants neurotisches Sicherheitsbedürfnis durchscheinen: Natürlich haben wir keine metaphysische Auffassung, die von allen – z.B. sowohl von mir als auch Herrn Wagner – angenommen wird, aber wir haben heute gründliche philosophische Untersuchungen der Indizien für und gegen die Existenz Gottes. Wer das nachprüfen möchte, sehe sich einmal die Sparte „Metaphysics“ auf philpapers.org an. Kant und Herrn Wagner ist das zu wenig „allgemein überzeugend“ und nennt den Streit deshalb einen „aussichtslosen Streit um des Kaisers Bart“. Zeigte die Metaphysik „allgemein überzeugend“, ob es einen Gott gibt, gäbe es dazu weder im Mercurio noch in der Philosophie Diskussionen. Alle Irrationalität würde überwunden. Herr Wagner bräuchte keine Artikel mehr schreiben, und ich auch nicht. Die Menschen müßten nicht mehr mit der Gottesfrage und dem Sinn ihres Lebens ringen. Wenn es einen Gott gibt, wäre das nicht in seinem Sinne, denn wir hätten dann keine Freiheit, ihn und das Evangelium anzunehmen oder abzulehnen, ihn zu lieben oder nicht. Die Existenz Gottes und die Wahrheit des Evangeliums sind nicht zuletzt durch die von Herrn Wagner als aussichtslos bezeichneten Überlegungen (ich empfehle, sie durch das Lesen des Buches „Gibt es einen Gott?“ des Oxforder Philosophen und Theologen Richard Swinburne zu vertiefen) hinreichend gewiß, so daß wir gerufen sind, Vergebung durch Christi Tod zu erflehen und Gott unser Leben zu verschreiben. Aber sie sind nicht so offensichtlich, daß wir nicht die Freiheit hätten, das Evangelium abzulehnen.
Prof. Dr. Dr. Daniel von Wachter
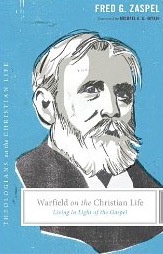 Benjamin Breckinridge Warfield, bekannt als
Benjamin Breckinridge Warfield, bekannt als 