E21-Regionalkonferenz in der Schweiz
In zwei Wochen ist es schon soweit. Die erste Konferenz in der Schweiz wird beginnen. Noch sind Anmeldungen möglich!

Mehr Informationen hier: www.evangelium21.net.
In zwei Wochen ist es schon soweit. Die erste Konferenz in der Schweiz wird beginnen. Noch sind Anmeldungen möglich!

Mehr Informationen hier: www.evangelium21.net.
 Friedrich von Schiller (1759-1805) ist in einem pietistischen Milieu in Marbach am Neckar aufgewachsen. Er distanzierte sich früh vom christlichen Glauben und beschäftigte sich mit religionsphilosophischen Fragen. Ergebnisse dieser Überlegungen hat er in seinen Schriften zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts festgehalten. Astrid Nettling hat für den DLF einen interessanten Beitrag über Schillers Religionsauffassung produziert:
Friedrich von Schiller (1759-1805) ist in einem pietistischen Milieu in Marbach am Neckar aufgewachsen. Er distanzierte sich früh vom christlichen Glauben und beschäftigte sich mit religionsphilosophischen Fragen. Ergebnisse dieser Überlegungen hat er in seinen Schriften zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts festgehalten. Astrid Nettling hat für den DLF einen interessanten Beitrag über Schillers Religionsauffassung produziert:
Diese Meldung des Evangelischen Pressedienstes hat es in sich. Aber das sie mich überrascht, kann ich nicht sagen. Das ist Symptom einer groben Fehlentwicklung. Die Zeit ist gekommen, die „Pia desideria“ von Philipp Jakob Spener wieder gründlich zu lesen.
Also:
In der württembergischen Landessynode gibt es Kritik an der Entscheidung der Evangelischen Fakultät Tübingen, in theologischen Unterrichtsräumen der Universität Tübingen keine christlichen Andachten zuzulassen. Der Nagolder Dekan Ralf Albrecht nannte es am Donnerstag in Stuttgart vor der Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg einen Skandal, dass Studierenden öffentliche Gebetsveranstaltungen im Tübinger Theologicum verboten worden seien.
Hintergrund ist ein Antrag evangelischer Theologiestudenten, zu Andachten im Theologicum öffentlich einladen zu dürfen. Das hatte die Fakultät abgelehnt. Wie der Dekan der Fakultät, Jürgen Kampmann, in einer Mail mitteilte, sollten Andach[t]en in Kirchen oder Kapellen stattfinden und nicht an der Universität. Lehrveranstaltungen oder die Arbeit in Bibliotheken dürften nicht beeinträchtigt werden.
Kritik an dieser Entscheidung übte der Vertreter der Tübinger Fakultät in der Synode, der Neutestamentler Hans-Joachim Eckstein. Es verschlage ihm selbst die Sprache, dass für Studentinnen und Studenten keine Gebetsveranstaltungen im Theologicum möglich seien. Eckstein verwies darauf, dass im Tübinger Zentrum für Islamische Theologie selbstverständlich in Studienräumen die muslimischen Gebete praktiziert würden.
Mehr: www.epd.de.
Kevin DeYoung schreibt über die Geschichtsverbundenheit der christliche Offenbarung (Taking God at His Word, 2014, S. 32):
Selbst wenn man dahingehend argumentiert, dass diese liberale Definition von Mythos nicht das ist, was das Neue Testament im Hinblick auf die „Mythen“ kritisiert, entkommt man der Logik von 2.Petrus 1,16 trotzdem nicht so leicht. Indem er seine Rolle als Augenzeuge bestätigt, verdeutlicht Petrus, wie sehr er sich wünscht, dass jeder weiß, dass die Geschichte von Jesus in die Kategorie historischer, nachweisbarer Fakten gehört und nicht in die Sparte „Eindrücke, innere Erlebnisse oder Geschichten, die erfunden wurden, um etwas Bestimmtes auszudrücken“. Im 2. Petrusbrief geht es zwar hauptsächlich um die verherrlichte Veränderung von Christi Gestalt auf dem Berg, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit meint Petrus ebenfalls den Rest des Evangeliums, welches er weitergegeben hat. Unter den Römern und den Griechen gab es viele mythologischen Geschichten. Ihnen war es egal, ob die Geschichten buchstäblich wahr waren oder nicht, da sich keiner für historische Belege der außerehelichen Zeugung von Herkules interessierte. Es war ein Mythos, eine Fabel, eine Legende, die den Zweck hatte, zu unterhalten und der Welt einen Sinn zu geben. Das Heidentum war auf die Macht der Mythologie gegründet – doch das Christentum, wie auch das Judentum, aus dem es entsprang, sah sich als eine völlig andere Religion. Dies lässt sich nicht deutlich genug betonen: Schon ganz von Anfang an band sich das Christentum sehr stark an die Historie. Die wichtigsten Behauptungen des Christentums sind allesamt historische Behauptungen und auf den Grundlagen der Historie steht oder fällt auch die christliche Religion.
In der Debatte über die sogenannte Homo-Ehe und deren mögliche Auswirkungen auf die Gesetzgebung zu Adoptionsrecht, Samenspende, Ei-Spende und Leihmutterschaft behaupten ihre Befürworter meist, es mache für das Kindeswohl keinen Unterschied, ob ein Kind bei einem gleichgeschlechtlich lebenden Paar oder bei Mutter und Vater bzw. einem Frau-Mann-Paar aufwächst.
Jeppe Rasmussen hat sich einige bedeutende Studien zum Thema näher angeschaut. Fazit:
Fast alle Studien, die nach eigenen Angaben keinen Unterschied zwischen den Familienformen feststellen konnten, zeigen erhebliche methodische Schwächen, verwenden keine repräsentativen Daten und ziehen häufig unzulässige Schlussfolgerungen. Manche der „Kein-Unterschied“-Studien weisen – nach einer erneuten Analyse der Daten – auf deutliche Unterschiede hin.
Die jüngsten Studien, die mit den größten Datensätzen arbeiten und repräsentative Stichproben nutzen, zeigen allesamt auf, dass das Kindeswohl in gleichgeschlechtlichen Familien gefährdeter ist als in anderen Familienformen. Der größte Unterschied besteht dabei zwischen Kindern in homosexuellen Haushalten und Kindern, die bei ihren gemeinsamen, leiblichen Eltern aufwachsen.
Was mögliche Auswirkungen einer rechtlich anerkannten „Ehe“ für homosexuell lebende Paare betrifft, sind zudem alarmierende Ergebnisse aufgetaucht: Die Untersuchung von Sullins zeigt, dass es Kindern bei gleichgeschlechtlich-verheirateten Paaren schlechter geht als bei gleichgeschlechtlich lebenden, aber nicht miteinander verheirateten Paaren. Die Resultate korrelierten statistisch mit der Dauer, die ein Kind bei einem homosexuell lebenden Paar verbracht hat: Je länger, desto schlechter ging es dem Kind. Der explorative Charakter dieser Ergebnisse legt nahe, dass weitere Untersuchungen notwendig sind.
Festzuhalten ist:
Kinder sind immer zu unterstützen, unabhängig davon, in welchen Beziehungskontexten sie aufwachsen. Nicht alle Beziehungskonstellationen aber sind gleich förderlich für ein Kind.
Es gehört zur Natur jedes Menschen, dass er einen Vater und eine Mutter hat. Zum Wohl der Kinder sollten wir das als Gesellschaft und als Einzelne im Blick behalten.
Hier mehr: www.dijg.de.
 Kirchen History ist das erste deutsche Magazin über Kirchengeschichte. Der Slogan lautet „Die Geschichte des christlichen Glaubens, spannend erzählt!“; und der ist Programm. Die Sprache ist leicht, verdaulich und kurzweilig. Wir verlieren uns nicht in Details, sondern stellen das wesentliche in den Mittelpunkt.
Kirchen History ist das erste deutsche Magazin über Kirchengeschichte. Der Slogan lautet „Die Geschichte des christlichen Glaubens, spannend erzählt!“; und der ist Programm. Die Sprache ist leicht, verdaulich und kurzweilig. Wir verlieren uns nicht in Details, sondern stellen das wesentliche in den Mittelpunkt.
Die erste Pilotausgabe ist derzeit in Planung. Dahinter steckt unter anderem Peter V., den viele vom Timotheus Magazin her kennen dürften. Das Erscheinen (für 2016 geplant) hängt vom grundsätzlichen Interesse der Leser ab. Deshalb gibt es derzeit eine Internetseite mit der Möglichkeit, seine Gedanken dazu preiszugeben. Je mehr Kommentare mit positiver Rückmeldung, desto höher stehen die Chancen, dass das Projekt letztendlich Realität wird.
Hier mehr Informationen und das Feedbackformular: kirchenhistory.wordpress.com.
Oswald Chambers vor ungefähr 100 Jahren:
Die pietistischen Erweckungsbewegungen unserer Zeit haben oft nichts von der rauhen Wirklichkeit des Neuen Testamentes an sich, nichts, das den Tod Jesu Christi zu einer Notwendigkeit macht; sie verlangen nur eine fromme Atmosphäre, Gebet und Hingebung. Diese Art des religiösen Erlebens ist weder übernatürlich noch wunderbar; sie musste nicht mit der Passion Gottes erkauft werden; sie ist weder mit dem Blute des Lammes gefärbt, noch mit dem Gepräge des Heiligen Geistes gestempelt; und sie trägt auch nicht jenes Merkmal an sich, das die Menschen mit ehrfürchtigem Staunen sagen lässt: ,Das ist das Werk des Allmächtigen‘. Davon und von nichts anderem ist im Neuen Testamente die Rede. Die persönliche leidenschaftliche Hingegebenheit an die Person Jesu Christi ist die Art der christlichen Erfahrung, von der im Neuen Testamente gesprochen wird. Jede andere sogenannte christliche Erfahrung ist von der Person Jesu Christi losgelöst, d. h. sie hat es nicht mit der Wiedergeburt zu tun – mit dem Neugeborenwerden in das Königreich Christi – sondern nur mit der Idee, dass Jesus Christus unser Vorbild sei. Im Neuen Testament ist Jesus Christus zuerst der Erlöser, ehe Er zum Vorbild wird. Heutzutage wird Er als Aushängeschild einer Religion und als bloßes Beispiel abgetan. Er ist ein Beispiel, doch ist Er noch unendlich viel mehr: Er ist die Erlösung selbst; Er ist das Evangelium Gottes.
Nachfolgend eine Rezension zum Buch:
die in dem Jahrbuch Religionsfreiheit 2015 erschienen ist:
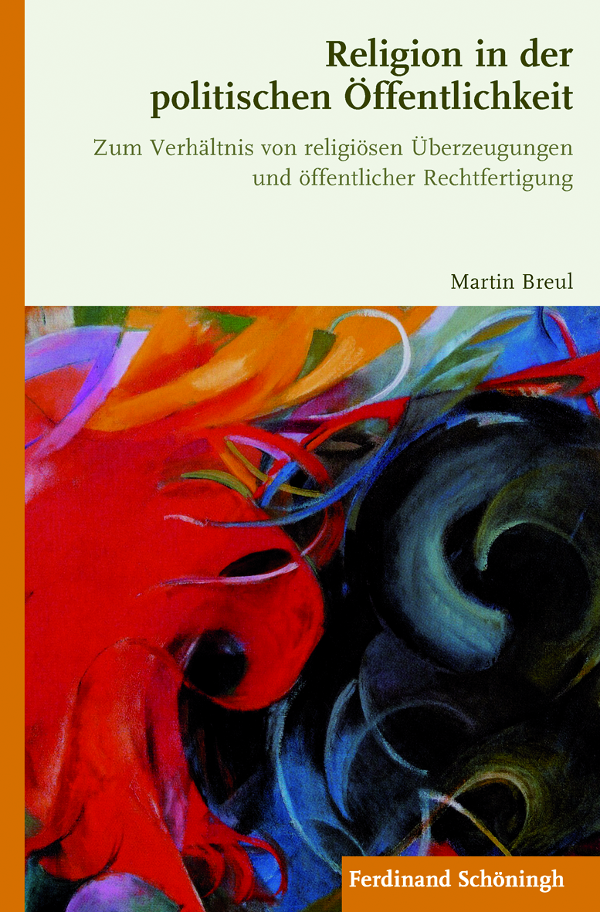 Nachdem der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seiner Vereidigung im Jahre 1998 auf das religiöse Bekenntnis „So wahr mit Gott helfe“ verzichtet hatte, begründete er seine Entscheidung mit dem Hinweis: „Religion ist Privatsache“ (das Beispiel wird in der Einleitung erwähnt, S. 11). Er nimmt damit, so sieht es jedenfalls zunächst aus, eine nachaufklärerische Position ein. „Religion scheint nur als ersetzbares Mittel zur Wahrung der persönlichen Psychohygiene, als esoterischer oder Überrest der Vormoderne, in jedem Fall als öffentlich nicht berücksichtigenswertes Phänomen betrachtet zu werden“ (S. 11). Allerdings haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass die Religion sehr wohl eine öffentliche Rolle spielt. Etliche politische Auseinandersetzungen sind – zumindest teilweise – religiös aufgeladen. „Das Verhältnis von Religion und Öffentlichkeit ist keineswegs eines der Nicht-Berührung, sondern ein Feld voller explosiver Konflikte“ (S. 11).
Nachdem der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seiner Vereidigung im Jahre 1998 auf das religiöse Bekenntnis „So wahr mit Gott helfe“ verzichtet hatte, begründete er seine Entscheidung mit dem Hinweis: „Religion ist Privatsache“ (das Beispiel wird in der Einleitung erwähnt, S. 11). Er nimmt damit, so sieht es jedenfalls zunächst aus, eine nachaufklärerische Position ein. „Religion scheint nur als ersetzbares Mittel zur Wahrung der persönlichen Psychohygiene, als esoterischer oder Überrest der Vormoderne, in jedem Fall als öffentlich nicht berücksichtigenswertes Phänomen betrachtet zu werden“ (S. 11). Allerdings haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass die Religion sehr wohl eine öffentliche Rolle spielt. Etliche politische Auseinandersetzungen sind – zumindest teilweise – religiös aufgeladen. „Das Verhältnis von Religion und Öffentlichkeit ist keineswegs eines der Nicht-Berührung, sondern ein Feld voller explosiver Konflikte“ (S. 11).
Eine der zentralen Fragen in der Debatte um das Verhältnis von demokratischer Öffentlichkeit und Religion ist die der Legitimität des Einbringens religiöser Überzeugungen und Argumente in die gewaltfreien Diskurse. Können in einer pluralistischen Gesellschaft religiöse Erklärungen zulässige Gründe innerhalb öffentlicher Auseinandersetzungen sein? Genau mit dieser Frage hat sich Martin Breul in seiner Dissertation beschäftigt, die im Wintersemester 2014/2105 von der Philosophischen Fakultät der Universität Köln angenommen und nun im Ferdinand Schöningh Verlag unter dem Titel Religion in der politischen Öffentlichkeit publiziert worden ist.
Das Werk untersucht, welche Chancen religiöse Argumente im öffentlichen Diskurs einer (post-)säkularen Gesellschaft bieten, aber auch, welche Risiken mit ihnen einhergehen. Das leitende Ziel ist dabei, ein zeit- und vernunftgemäßes Verhältnis von politischer Öffentlichkeit, religiösen Überzeugungen und demokratischer Legitimität zu bestimmen. Die These ist, dass in der Debatte um die Zulässigkeit religiöser Argumente zwischen einem exklusiven und einem inklusiven Ansatz eine vermittelnde Position vertreten werden kann.
Diese Position bezeichnet der Autor als „Moderaten Exklusivismus“. „Der moderate Exklusivismus besagt, dass es einerseits notwendig ist, am Ideal der Rechtfertigungsneutralität festzuhalten: Nur solche politischen Normen sind legitim, die mit Gründen gerechtfertigt werden können, die von allen möglicherweise Betroffenen geteilt werden können (exklusives Moment). Zugleich impliziert dieses Insistieren auf der Notwendigkeit wechselseitig akzeptabler Rechtfertigungen keine Privatisierungsforderung, da jenseits der Rechtfertigungsfunktion eine Vielzahl anderer Rollen für religiöse Überzeugungen in öffentlichen Diskursen denkbar ist (moderierendes Moment). So soll einerseits eine liberale Pauschaldiskriminierung religiöser Argumentationsformen durch den apriorischen Diskursausschluss vermieden und andererseits eine ungerechtfertigte Herrschaft einer weltanschaulichen Mehrheit durch die kriterienlose und ungefilterte Zulassung religiöser Argumente und Überzeugungen verhindert werden“ (S. 13) .
Um diese Position zu begründen, geht Breul in drei Schritten vor: Zunächst rekonstruiert er die unübersichtliche politisch-philosophische Debatte. Er arbeitet dabei nicht autorenbasiert, sondern rekonstruiert vier Argumenttypen. Der erste Typ beruft sich auf konsequenzialistische Argumente. Diese Argumente thematisieren die positiven und negativen Folgen religiöser Überzeugungen für das Gemeinwesen. Der zweite Typ umfasst ethische Argumente. Der dritte Typ formuliert politische Argumente, in der Regel Bedingungen für die Stabilität eines pluralistischen Gemeinwesens. Im vierten Typ werden alle erkenntnistheoretischen Argumente zusammengetragen. Anschließend prüft Breul die religionsphilosophischen Erkenntnisse von Jürgen Habermas und findet unter ihnen Anknüpfungspunkte, insbesondere deshalb, weil er die Fronstellungen zwischen liberalen und nicht-liberalen Ansätzen aufbricht. Andererseits überzeugt ihn Habermas jedoch nicht. Nach Habermas ist religiöser Glaube für die Philosophie eine kognitive Zumutung. Die Sphären von Glauben und Wissen sind nämlich inkommensurabel, also nicht miteinander vergleichbar. Warum? Religiösen Aussagen fehlt a) die propositionale Verfasstheit, sie sind also nicht wahrheitsfähig. Sie sind b) von einer göttlichen Offenbarung abhängig, c) in kultischer Praxis verankert und d) als Heilsweg ausgezeichnet (vgl. S. 155). Alle vier Behauptungen sind für Breul zu recht heikel. Deshalb verlässt er die Argumentationslinie von Habermas und legt schließlich drittens mit seinem moderaten Exklusivismus einen eigenen Entwurf vor. Es soll gelingen, „sowohl die plausible liberale Intuition der Notwendigkeit einer allgemein akzeptablen Rechtfertigung politischer Normen als auch die plausible Intuition der Gegenseite, eine apriorische Diskriminierung religiöser Überzeugungen durch eine pauschale Privatisierungsforderung zu vermeiden, zu verknüpfen und beiden Intuitionen gleichermaßen gerecht zu werden“ (S. 13–14).
Breul akzeptiert also einerseits die Forderung nach Rechtfertigungsneutralität, lehnt aber die davon abgeleitete Privatisierungforderung religiöser Überzeugungen ab. Religiöse Überzeugungen enthalten, so Breul, immer auch kognitive Elemente (belief) und sind somit der Vernunft zugänglich und intersubjektiv nachvollziehbar. Sie müssen auch in postsäkularen Gesellschaften nicht aus den öffentlichen Diskursen verbannt werden.
Die Arbeit ist sehr interessant zu lesen, der Autor argumentiert klar verständlich und liefert etliche treffende und hilfreiche Analysen. Hervorzuheben ist, dass er ein de-universalisiertes Vernunftkonzept ablehnt, „da es weder möglich ist, rechtfertigungstheoretische Willkür und einen Perspektivenrelativismus zu vermeiden, noch die Möglichkeit von kontextübergreifender Kritik gewahrt werden kann“ (S. 246).
Leider fehlt die Auseinandersetzung mit der sogenannten reformierten Erkenntnistheorie (z. B. Alvin Plantinga, Nicholas Woltersdorf, für eine kurze Einführung siehe: Plantinga.pdf), obwohl es beachtliche materielle Schnittmengen gibt. Diese Schule hat nicht nur gezeigt, dass der Glaube an Gott basal und dennoch rational verantwortbar ist, sie zeigt auch, dass diejenigen, die sich auf rein vernünftige Legitimationsprinzipien berufen, ohne Glauben (faith) nicht auskommen. Sogar unter Religionslosen, die sich vehement von allem Übernatürlichem abgrenzen, sind Haltungen und Einstellungen zu finden, die quasi transzendentalen Charakter haben.
Das große Anliegen Martin Breuls ist zu begrüßen. Er möchte einen transparenten Ansatz liefern, der das friedliche Zusammenleben in einer pluralen, multikulturellen und demokratischen Gesellschaft ermöglicht, ohne das dabei der Wahrheitsanspruch religiöser Überzeugungen geopfert werden muss. Insofern religiöse Überzeugungen kriterielle Minimalstandards für vernünftige, öffentliche Diskurse erfüllen, können und sollen sie auch in die politischen Debatten eingebracht werden.
Ron Kubsch
Selbstverliebte Narzissten sind eloquent und charmant, ziehen alle Blicke auf sich, wenn sie einen Raum betreten. An Beziehungen liegt ihnen allerdings nicht sehr viel. DIE WELT nennt in Anlehnung an die Untersuchungen von Craig Malkin fünf Kriterien, an denen man einen Narzissten gut erkennen kann:
Hier mehr: www.welt.de.
Die Kirche von England hat einen gut gemachten und völlig harmlosen Werbespot produziert, der zur Weihnachtszeit in den Kinos gezeigt werden soll. Doch viele Filmtheater weigern sich, den Spot zu zeigen, da Besucher beleidigt werden könnten!
Hier der 54 Sekunden lange Clip:
Ein kurzer Artikel dazu wurde von der WELT veröffentlicht: www.welt.de.