Bin gerade zurückgekehrt von den Beratungen in Kassel und sehe, dass idea bereits das Kommuniqué veröffentlicht hat. Die Atmosphäre war ernst und konstruktiv, wofür ich sehr dankbar bin. Also hier der Text:
Kommuniqué über die Beratungen zum Thema
„Gemeinsam widerstehen und Christen in den Auseinandersetzungen um Grundfragen des christlichen Glaubens Orientierung geben“
Wir, 65 Personen aus evangelischen Kirchen, Landeskirchlichen Gemeinschaften und Freikirchen, sind am 23. Januar 2016 in Kassel zu Beratungen zusammengekommen.
Folgende Beobachtungen haben uns dazu veranlasst:
In den evangelischen Kirchen werden die Grundlagen des Glaubens zunehmend demontiert. In Frage gestellt wird insbesondere
- die Autorität der Bibel als Wort Gottes und höchste Norm für Glauben und Leben,
- dass Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist,
- dass Gott durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung die Welt mit sich versöhnt hat,
- dass zur Offenbarung Gottes die Gottebenbildlichkeit des Menschen mit der Polarität und Gemeinschaft von Mann und Frau gehört,
- dass die Gebote Gottes auch heute die gültigen Maßstäbe für das Leben der Christen und der Gemeinden sind.
In vielen Gemeinden und Gemeinschaften herrscht Verwirrung und besteht Besorgnis darüber, welchen Kurs führende Repräsentanten der evangelikalen Bewegung steuern.
Es fehlt an deutlichem Widerstand gegen Entscheidungen von Kirchenleitungen und Synoden, die eindeutig Bibel und Bekenntnis widersprechen. Das betrifft aktuell die Beschlüsse zur Segnung und kirchlichen Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren, die kirchliche Förderung der Gender-Ideologie und Verlautbarungen zum interreligiösen Dialog.
Wir sind uns über die Bekenntnisgrundlagen einig, auf deren Basis wir weiter gemeinsam handeln wollen.
Wir sind den altkirchlichen Bekenntnissen (Apostolicum, Nicaenum, Athanasianum) und den Bekenntnisschriften unserer verschiedenen Kirchen verpflichtet.
Wir sind dankbar für die Klarheit der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Deren Aussage „Wir bekennen uns… zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung“, gibt uns auch heute klare Orientierung.
In einigen neueren Bekenntnissen sehen wir ebenfalls notwendige und hilfreiche Orientierung. Zu nennen sind:
Wir unterstützen den Aufruf „Zeit zum Aufstehen, Ein Impuls für die Zukunft der Kirchen“, den viele von uns unterschrieben haben.
In den gegenwärtigen Auseinandersetzungen halten wir folgende Konkretion für nötig:
- „Wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung“. (Glaubensbasis der Evangelischen Allianz)
- Wir stehen dafür ein, dass die rettende Botschaft von Jesus Christus allen Menschen gilt, den Juden zuerst. (Römer 1,16)
- Wir widersprechen der falschen Lehre, es gäbe auch andere Wege zum Heil.
- Wir widersprechen der falschen Lehre, dass Menschen durch die Taufe ohne den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. (Markus 16,16)
- Wir stehen dazu, dass gemäß der Offenbarung Gottes der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen wurde und dass die Polarität und Gemeinschaft von Mann und Frau zu dieser Ebenbildlichkeit gehört, wie Jesus Christus es ausdrücklich bestätigt hat. (1.Mose 1,26-28; Matthäus 19,4-6)
- Wir widersprechen der falschen Lehre, gleichgeschlechtliche Beziehungen entsprächen dem Willen Gottes und dürften von den Kirchen gesegnet werden.
Wir sind uns einig, dass im Gegensatz zum postmodernen Denken das Bekenntnis zu Jesus Christus und der Lehre der Apostel mit logischer und theologischer Notwendigkeit die Verwerfung falscher Lehren einschließt. So widersprechen wir Ansichten wie zum Beispiel:
- Man müsse für zentrale biblische Wahrheiten eintreten, doch gleichzeitig seien gegensätzliche Verständnisse und Lesarten der Bibel zu akzeptieren.
- Es sei dem Anliegen einer geistlichen Erneuerung der Kirche nicht zuträglich, wenn Missstände offen kritisiert werden. Ein „Ruf zur Mitte“ dürfe nicht ergänzt werden durch die Verwerfung von Irrlehre.
- Biblisch orientierte Gemeinden hätten ein Toleranzproblem und müssten sich für Pluralität in Lehrfragen öffnen. Sie müssten auch solche Mitchristen akzeptieren, die in Sünde leben und die diese Sünde gegen Gottes Willen rechtfertigen.
- Weil Jesus ein „Liebhaber“ und kein „Rechthaber“ gewesen sei, dürfe es auch keinen offenen, energischen Streit um die Wahrheit geben, wie er aber bei Jesus, bei den Aposteln, bei den Reformatoren und den Vätern der Barmer Erklärung stattfand.
Wir fordern die zuständigen Gremien des Gnadauer Verbandes und der Deutschen Evangelischen Allianz auf, zu diesen Irritationen klärend Stellung zu beziehen und bitten um gemeinsame Gespräche.
Wir fordern die evangelikalen und pietistischen Verbände und die Bekenntnisgemeinschaften auf, das Reformationsjubiläum 2017 für Veranstaltungen zu nutzen, bei denen die reformatorischen Prinzipien „Allein Christus, Allein die Schrift, Allein die Gnade, Allein der Glaube“ öffentlich bekannt werden und zugleich benannt wird, wo diese reformatorische Basis verloren zu gehen droht. Wir erklären uns bereit, bei diesen Veranstaltungen inhaltlich und organisatorisch mitzuwirken.
Wir laden alle Verantwortlichen in Kirchengemeinden, Gemeinschaften und Freikirchen ein, sich diesem Vorhaben anzuschließen. Wir wollen klären, stärken und einigen in der Wahrheit und nicht in der Unklarheit. Wir rufen auf zum Gebet für die Erneuerung unseres Lebens und unserer Gemeinden, Gemeinschaften und Kirchen.
Zur Weiterführung unserer Anliegen wurde eine Fortsetzungsgruppe unter Leitung von Pfr. Ulrich Parzany gebildet, der folgende Personen angehören: Sr. Heidi Butzkamm, Pfr. Dr. Tobias Eißler, Gemeinschaftspastor Martin Grünholz, Prof. Dr. Rolf Hille, Pfr. Johannes Holmer, Pfr. Ulrich Rüß, Pfr. Dirk Scheuermann, Rektor Dr. Rolf Sons, Prof. Dr. Dr. Daniel von Wachter.
Die Veröffentlichung dieses Kommuniqués wurde einstimmig beschlossen.
Kassel, den 23. Januar 2016
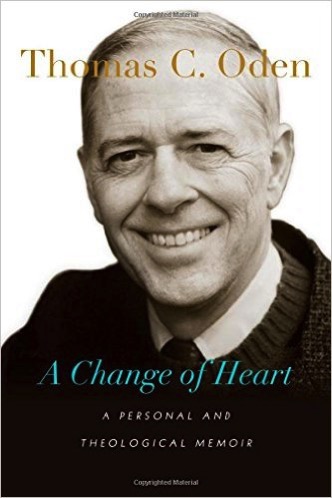 Wir hören und lesen heute immer wieder davon, dass Menschen sich vom christlichen Glauben abkehren. Aber was ist mit den Leuten, die den schriftgemäßen Glauben an Jesus Christus finden oder zu ihm zurückfinden? Sie werden oft ignoriert.
Wir hören und lesen heute immer wieder davon, dass Menschen sich vom christlichen Glauben abkehren. Aber was ist mit den Leuten, die den schriftgemäßen Glauben an Jesus Christus finden oder zu ihm zurückfinden? Sie werden oft ignoriert.
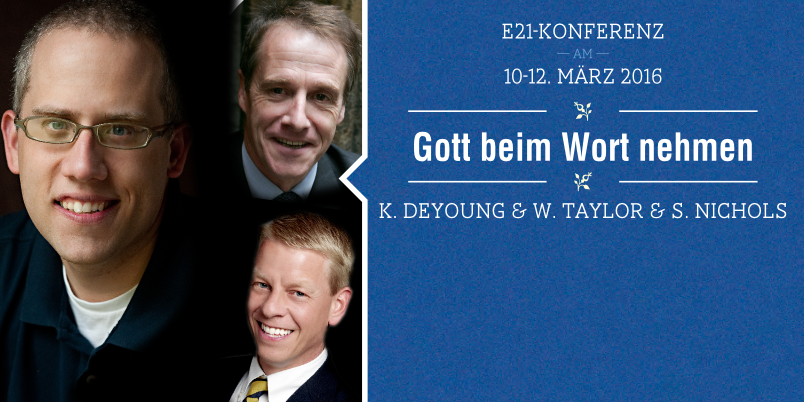
 In der Türkei mehren sich die Stimmen, die vor einem schnellen Abgleiten des Landes in den Faschismus warnen. So spricht Orhan Kemal Cengiz in seiner Kolumne in der englischsprachigen türkischen Zeitung „Today’s Zaman“ vom 15. Januar von „Unverkennbaren Anzeichen faschistischer Tendenzen“. Hier der Artikel (allerdings auf Englisch):
In der Türkei mehren sich die Stimmen, die vor einem schnellen Abgleiten des Landes in den Faschismus warnen. So spricht Orhan Kemal Cengiz in seiner Kolumne in der englischsprachigen türkischen Zeitung „Today’s Zaman“ vom 15. Januar von „Unverkennbaren Anzeichen faschistischer Tendenzen“. Hier der Artikel (allerdings auf Englisch):