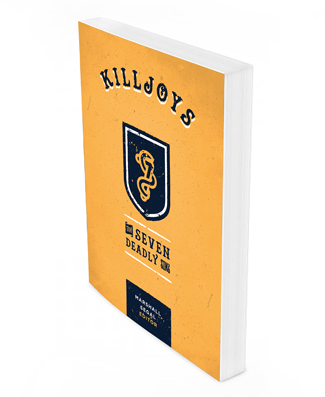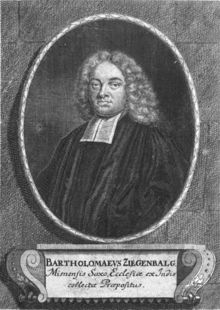 Vor vielen Jahren hatte ich das Vorrecht, Niels Peter Moritzen bei der Herausgabe von zwei Werken aus der Frühgeschichte der evangelischen Mission zu unterstützen. Die Schrift „Kurze Beschreibung der Tätigkeit der Mission“ wurde am 21. Juli 1717 in Tranquebar/Südindien in lateinischer Sprache von der Missionsdruckerei veröffentlicht. Als Autoren zeichnen die beiden Indienmissionare B. Ziegenbalg und J.E. Gründler.
Vor vielen Jahren hatte ich das Vorrecht, Niels Peter Moritzen bei der Herausgabe von zwei Werken aus der Frühgeschichte der evangelischen Mission zu unterstützen. Die Schrift „Kurze Beschreibung der Tätigkeit der Mission“ wurde am 21. Juli 1717 in Tranquebar/Südindien in lateinischer Sprache von der Missionsdruckerei veröffentlicht. Als Autoren zeichnen die beiden Indienmissionare B. Ziegenbalg und J.E. Gründler.
Prof. Moritzen, der die Schrift übersetzte und damit erstmals einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machte, schreibt in seiner Einführung: „Diese Darstellung ist ein faszinierendes Beispiel für eine sachliche und werbende Missionsberichterstattung, die sich an Mitchristen wendet. Sie macht nicht nur den äusseren Aufbau der Arbeit, sondern auch das Selbstverständnis der führenden Missionare recht deutlich und ist so als eine Einführung recht brauchbar“ (Bartholomäus Ziegenbalg u. Johannes Ernst Gründler, Von den Anfängen evangelischer Mission, hrsg. von Niels Peter Moritzen, Bonn, 2002, S. 7).
Die beiden Verfasser der Schrift „Kurze Beschreibung der Tätigkeit der Mission“ beschreiben unter Abschnitt XXV die Verkündigung des Evangeliums. Das gefällt mir natürlich:
Durch die Ankündigung des Evangeliums wird den Menschen der übergroße und allerkostbarste Schatz vorgestellt und dargeboten. Wer diesen annimmt und in seinem Gemüt wirklich zu eigen hat, der hat das Brot des Lebens; wer es isst, wird in Ewigkeit leben. Er hat eine Quelle lebendigen Wassers; wer daraus Wasser trinkt, wird in Ewigkeit nicht dürsten. Ja Ströme lebendigen Wassers fließen von seinem Leibe. Er hat das Licht der Welt, und wer dem folgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Er hat den Weg, und nur dieser führt uns zum ewigen Leben. Er hat die Pforte, durch die wir zur Teilnahme am Himmelreich eingehen. Dieser allerkostbarste und himmlische Schatz ist JESUS CHRISTUS, und zwar der gekreuzigt und von den Toten auferstanden ist. Er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.
Aber beeindruckend ist auch, was die Missionare über die Zielsetzung der errichteten Schulen kundtun. Es heißt dazu unter XIII.:
Das wichtigste Ziel in diesen Schulen ist: 1) Die wahre Frömmigkeit oder Erkenntnis der Wahrheit nach Art der Frömmigkeit in ihre Seelen zu pflanzen. 2) Das Wort Gottes und die göttlichen Wahrheiten aus der Heiligen Schrift selbst ihnen vertraut zu machen. 3) Die Lehren des wahren Christentums aus der Heiligen Schrift und anderen christlichen Büchern so zu lehren, daß sie den wahren Sinn und Zusammenhang der ganzen Ordnung der Gnade und des Heils erfassen, wie Gott in unseren Seelen das Werk der Erlösung bewirkt. 4) Den wahren Gebrauch und Sinn christlicher Schriften durch die Erziehung der Kleinen in diesen bisher dunklen Ländern einzuführen. 5) Die Schüler zu guten Sitten zu erziehen, damit die eingeübten Sitten der Heiden ausgelöscht und eine christliche Kultur der Seelen begründet werde. 6) Die biblische Geschichte nach ihrem Zusammenhang ihnen einzuprägen. 7) Rechtschreibung und Rechenkunst zu lehren. 8) Ihnen einen guten Stil anzugewöhnen usw.
Es folgt ein – wie ich meine – besonders wertvoller Abschnitt. Unter XIV. beschreiben die Missionare, wie sie einige begabte und fortgeschrittene tamulische Schüler für den Missions- und Pastorendienst vorbereiten. Zu ihren Aufgaben gehört:
1) Täglich halten sie fortlaufende biblische Lesung. 2) Kernstellen der Bibel werden auswendig gelernt. 3) Die thetische Theologie lernen sie ernstlich. 4) An den oben kurz beschriebenen tamulischen Schulen halten sie Katechisationen. 5) Die Predigten, die die Missionare öffentlich halten, schreiben sie in der Kirche aus ihrem Munde eilends mit Eilschrift auf, bedenken sie zu Hause und wiederholen sie vor der Versammlung der Schüler und Katechumenen aus dem Gedächtnis. 6) Gewisse theologische Stoffe und biblische Aussagen werden ihnen zur Erklärung vorgelegt, die sie nach ausreichender privater Verarbeitung und nach tamulischer Niederschrift auf Papier, wohlbedacht zum Vortrag ihrer Überlegungen vor den übrigen Schülern Gelegenheit haben. 7) Die biblische Geschichte machen sie sich durch häufigen Unterricht und Lesung vertraut. 8) Sie besuchen das Collegium Biblicum et Exegeticum, d.h. die Bibelauslegungsstunde bei den Missionaren. 9) Sie bemühen sich um medizinische Kenntnisse nach den Prinzipien der tamulischen Ärzte sowohl theoretisch wie praktisch. 10) Sie lernen das Portugiesische, Geographie und Kenntnis des Globus usw.
Na, da können wir heute viel lernen!
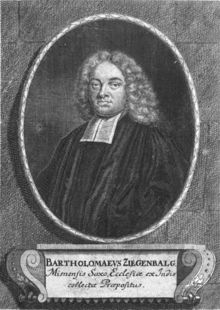 Vor vielen Jahren hatte ich das Vorrecht,
Vor vielen Jahren hatte ich das Vorrecht,