Die Rückkehr des Absoluten
Im 20. Jahrhundert ist das moderne Weltbild, das stark von den Naturwissenschaften und der Suche nach Einheit geprägt war, zunehmend unter Druck geraten. Nicht mehr die Wirklichkeit, an der sich verschiedenste Deutungen abarbeiten und bewähren müssen, stand im Zentrum menschlicher Erkenntnisbemühungen, sondern ihre ausschließlich in Sprache entworfenen Interpretationen. Anstelle der Annahme, Sprache sei ein geeignetes Mittel, um Wirklichkeit abzubilden, zu verstehen und zu vermitteln, trat die Überzeugung, Sprache sei eine unhintergehbare Bedingung menschlichen Denkens. Jede menschliche Erkenntnis sei durch Sprache strukturiert. Alle Realität jenseits von Sprache bleibe für immer unerreichbar. Der Mensch sei wie in einem Gefängnis eingeschlossen in der Welt seiner Sprache.
So wurden Dekonstruktivismus, Konstruktivismus und Relativismus populär: Da die Bedeutung unserer Begriffe durch ihren Gebrauch innerhalb von sozialen Gemeinschaften (oder Kulturen) bestimmt wird, stellen wir Wirklichkeit in einem andauernden Vollzug des miteinander Redens und Handelns her. Jede Gemeinschaft spricht dabei ihre eigene Sprache, schafft sich je eigene Welten (oder Sprachspiele). So gibt es so viele Welten, wie es soziale Gemeinschaften gibt und so viele Wahrheiten wie Gemeinschaften. Philosophie beschreibt folglich nicht die Welt, wie sie ist, sondern ist Vorstellung, die in verschiedenen Gruppenkulturen und Kontexten entworfen wird. Die Suche nach Einheit kann unter diesen Voraussetzungen nur in den Terror führen. Einer der achtenswertesten Denker der Postmoderne forderte entsprechend: „Krieg dem Ganzen, …, aktivieren wir die Widerstreite“ „Jean-François Lyotard, „Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?“, in: Peter Engelmann (Hg.), Postmoderne und Dekonstruktion, 1990, S. 33–48, hier S. 48).
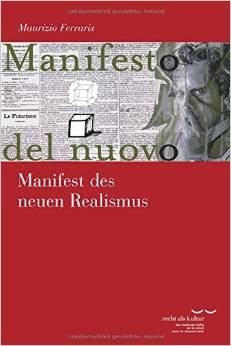 Mit zwei neuen geisteswissenschaftlichen Strömungen, dem „Neue Realismus“ und dem „Spekulative Realismus“, kehrt das Absolute nun allmählich zurück. Unter dem Dekonstruktionsdrang der postmodernen Denkkultur ist ihrer Meinung nach die wirkliche Welt zu einer Fabel geworden (M. Ferraris, Manifest des neuen Realismus 2014, S. 15–17). Die Kinder und Enkelkinder der postmodernen Geisteswissenschaften bereiten einen „Paradigmenwechsel“ vor. Ihr gemeinsamer Absetzungspunkt ist eine „spätestens seit Ende des 20. Jahrhunderts erschöpfte (post)moderne Kondition“. Charakteristisch für die Denkansätze ist „ihr positives Verhältnis zur Ontologie und ihr entspannter Umgang mit der Metaphysik“ (A. Avanessian (Hg.), Realismus jetzt, 2013, S. 6.). „Im Zentrum des Interesses steht eine Realität“, schreibt Avenessian, „die sich indifferent zur subjektiv-humanen Erkenntnis verhält und sich nicht über ein subjektivistisch oder anthropozentrisch bedingtes Wissen vermitteln lässt, also nicht primär kulturell, linguistisch, politisch oder historisch kodifiziert ist“ (A. Avanessian (Hg.), Realismus jetzt, 2013, S. 8).
Mit zwei neuen geisteswissenschaftlichen Strömungen, dem „Neue Realismus“ und dem „Spekulative Realismus“, kehrt das Absolute nun allmählich zurück. Unter dem Dekonstruktionsdrang der postmodernen Denkkultur ist ihrer Meinung nach die wirkliche Welt zu einer Fabel geworden (M. Ferraris, Manifest des neuen Realismus 2014, S. 15–17). Die Kinder und Enkelkinder der postmodernen Geisteswissenschaften bereiten einen „Paradigmenwechsel“ vor. Ihr gemeinsamer Absetzungspunkt ist eine „spätestens seit Ende des 20. Jahrhunderts erschöpfte (post)moderne Kondition“. Charakteristisch für die Denkansätze ist „ihr positives Verhältnis zur Ontologie und ihr entspannter Umgang mit der Metaphysik“ (A. Avanessian (Hg.), Realismus jetzt, 2013, S. 6.). „Im Zentrum des Interesses steht eine Realität“, schreibt Avenessian, „die sich indifferent zur subjektiv-humanen Erkenntnis verhält und sich nicht über ein subjektivistisch oder anthropozentrisch bedingtes Wissen vermitteln lässt, also nicht primär kulturell, linguistisch, politisch oder historisch kodifiziert ist“ (A. Avanessian (Hg.), Realismus jetzt, 2013, S. 8).
Wolfgang Welsch trauert dem alten Denken mit keiner Silbe nach. Er schreibt (Wolfgang Welsch, Mensch und Welt, 2012, S. 23–24):
„Denn das Befangensein in dieser [postmodernen, R.K.] Denkform lähmt unser Denken. Man weiß immer schon die Antwort auf alle Fragen. Sie lautet: ‚Es ist der Mensch.‘ Diese Trivialität aber erstickt unser Denken, statt ihm Atem zu verleihen. In der Tat scheint die zeitgenössische philosophische und intellektuelle Szenerie eigentümlich gelähmt. Gewiss ist die Betriebsamkeit immens und die Differenziertheit im Detail beeindruckend. Aber alles dreht sich in einem zum Überdruss bekannten Kreis. Bei allem, was wir im Einzelnen noch nicht wissen mögen und uns zu erforschen vornehmen, halten wir doch eines stets vorweg schon für sicher: dass all unser Erkennen, das gegenwärtige wie das zukünftige, menschlich gebunden ist und nichts anderes als menschlich bedingte und bloß menschlich gültige Einsichten hervorbringen wird. Noch das heutige Alltagsbewusstsein ist davon bis zur Bewusstlosigkeit durchdrungen. Wenn wir in der Moderne noch eine Gemeinsamkeit haben, dann den Glauben, dass unser Weltzugang in allem menschgebunden (kontext-, sozial-, kulturgebunden) ist. Das ist die tiefste communis opinio des modernen Menschen. Wenn jemand diese Auffassung hingegen nicht teilt und kritische Fragen zu stellen beginnt, dann reibt man sich verwundert die Augen: Dieser Kerl scheint nicht von dieser Welt zu sein – anscheinend ist er verrückt.“
 Der Postmodernismus ist aus der Überzeugung erwachsen, „dass alles Wesentliche oder überhaupt alles konstruiert sei – von der Sprache, von den Begriffsschemata, von den Medien“ (M. Ferraris, „Was ist der neue Realismus?“, in: M., Der Neue Realismus 2014, S. 52–75, hier S. 52). Viele zeitgenössischen Philosophen sagen dagegen: „Nein, irgendetwas, sogar deutlich mehr, als wir üblicherweise bereit sind zuzugeben, ist nicht konstruiert, und das ist ein Glück, andernfalls könnten wir zwischen Traum und Wirklichkeit nicht unterscheiden“ (M. Ferraris, „Was ist der neue Realismus?“, 2014, S. 52). „Es gibt ein Absolutes, das nicht auf das Denken angewiesen ist, sondern unabhängig von jeder kognitiven Bezugnahme existiert“ (A. Avanessian, „Editorial“, in: Armen Avanessian (Hg.), Realismus jetzt, 2013, S. 7).
Der Postmodernismus ist aus der Überzeugung erwachsen, „dass alles Wesentliche oder überhaupt alles konstruiert sei – von der Sprache, von den Begriffsschemata, von den Medien“ (M. Ferraris, „Was ist der neue Realismus?“, in: M., Der Neue Realismus 2014, S. 52–75, hier S. 52). Viele zeitgenössischen Philosophen sagen dagegen: „Nein, irgendetwas, sogar deutlich mehr, als wir üblicherweise bereit sind zuzugeben, ist nicht konstruiert, und das ist ein Glück, andernfalls könnten wir zwischen Traum und Wirklichkeit nicht unterscheiden“ (M. Ferraris, „Was ist der neue Realismus?“, 2014, S. 52). „Es gibt ein Absolutes, das nicht auf das Denken angewiesen ist, sondern unabhängig von jeder kognitiven Bezugnahme existiert“ (A. Avanessian, „Editorial“, in: Armen Avanessian (Hg.), Realismus jetzt, 2013, S. 7).
 Die Kultur des „anything goes“, die sowieso nur in einigen elitären Zirkeln und im Medienpopulismus zelebriert wird, erfährt also eine Umwandlung. Das neue Denken richtet sich wieder stärker an einer vorgegebenen Wirklichkeit aus. Die realistischen Strömungen rehabilitieren die durch den Postmodernismus verwischte Unterscheidung zwischen dem, was es gibt (Ontologie) und jenem, was wir erkennen (Epistemologie).
Die Kultur des „anything goes“, die sowieso nur in einigen elitären Zirkeln und im Medienpopulismus zelebriert wird, erfährt also eine Umwandlung. Das neue Denken richtet sich wieder stärker an einer vorgegebenen Wirklichkeit aus. Die realistischen Strömungen rehabilitieren die durch den Postmodernismus verwischte Unterscheidung zwischen dem, was es gibt (Ontologie) und jenem, was wir erkennen (Epistemologie).
Christen, die im Blick auf die Kultur des Unglaubens sprachfähig bleiben möchten, sind gut beraten, wenn sie sich auf das neue Klima einstellen. Das Reale, die Metaphysik, das Vernünftige, das Klare, werden zurückkehren.
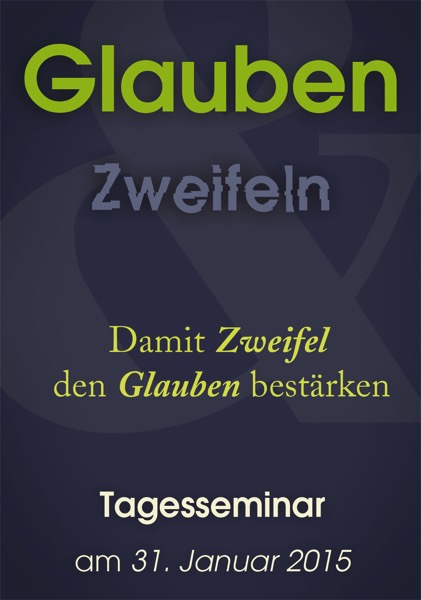
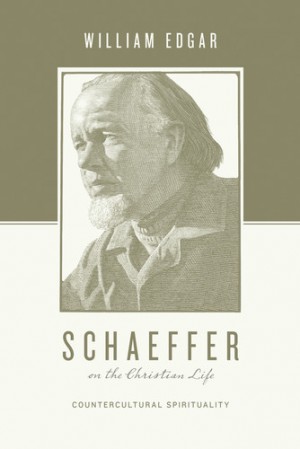 William Edgar hat Francis Schaeffer in L’Abri kennengelernt und nun ein Buch über ihn geschrieben. Hier ein paar Empfehlungen für
William Edgar hat Francis Schaeffer in L’Abri kennengelernt und nun ein Buch über ihn geschrieben. Hier ein paar Empfehlungen für