Mattson und Eglinton reden über Bavinck
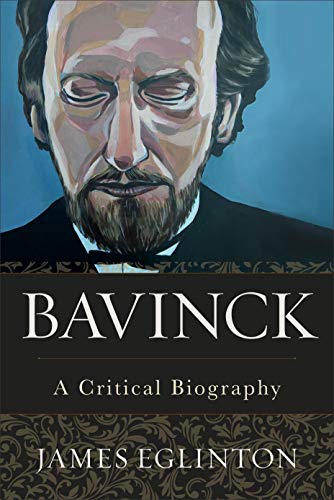 Wenn zwei ausgewiesene Bavinck-Experten wie Brian Mattson und James Eglinton sich unterhalten, lohnt es sich, mal „reinzuhören“. Evangelium21 hat ihr Gespräch in die deutsche Sprache übersetzt.
Wenn zwei ausgewiesene Bavinck-Experten wie Brian Mattson und James Eglinton sich unterhalten, lohnt es sich, mal „reinzuhören“. Evangelium21 hat ihr Gespräch in die deutsche Sprache übersetzt.
Wie wahr und hilfreich, was Eglinton hier über Bavincks späte überkonfessionelle Apologetik sagt:
In meiner Biografie wird dieser Wandel auf eine Gesinnungsänderung um 1900 zurückgeführt, das Jahr, in dem der deutsche Atheist und Philosoph Friedrich Nietzsche verstarb. Zu Lebzeiten war Nietzsche in den Niederlanden relativ unbekannt. Aus dem wenigen, was Bavinck damals über ihn schrieb, kann gefolgert werden, dass er kaum mehr als die Titel seiner Bücher gelesen, Nietzsche aber nicht studiert hatte. Nach seinem Tod wuchs Nietzsches Bekanntheit jedoch in den Niederlanden enorm. Neben Nietzsches offener Abscheu gegen Jesus (aufgrund seiner freiwilligen Schwäche und dienenden Haltung) war seine revolutionärste Idee, dass wir, wenn „Gott tot ist“, nicht zur Einhaltung der moralischen Werte des Theismus verpflichtet sind. Aus diesem Grund hatte diese neue Ausrichtung des Atheismus das Potential für drastische moralische Folgen.
Angesichts der plötzlichen Popularität Nietzsches nach seinem Tod realisierte Bavinck, dass die Verteidigung des Neo-Calvinismus allein nicht ausreicht, da die Anhänger Nietzsches jede Form des Christentums verabscheuten – sowohl liberal als auch orthodox – und dem Christentum an sich ein Ende bereiten wollten. In der Biografie beschreibe ich Bavincks Erkenntnis so, dass Nietzsche nicht mit einer Gartenschere zu dem Baum des Christentums gekommen war, sondern mit einer Axt. Für Nietzsche musste das ganze Ding weg, nicht nur einige Äste. Und damit standen Bavinck und seine theologischen Rivalen vor einer gemeinsamen existenziellen Bedrohung. In diesem Kontext begann Bavinck neben seiner ungebrochenen Unterstützung des Neo-Calvinismus, das Christentum allgemeiner zu verteidigen. Die Art, wie er die Balance hält zwischen seiner Förderung des Christentums allgemein und dem Festhalten an eigenen Traditionen, erinnert an C.S. Lewis’ Pardon, ich bin Christ oder als jüngeres Beispiel Tim Keller.
Welche Relevanz hat dieser Gesinnungswandel für uns heute? Wir leben immer noch in Nietzsches Schatten. Die westliche Kultur ist unersättlich hungrig nach Macht, getrieben von der Suche nach Vorherrschaft, verachtet das Schwache und Verletzliche und hat eine moralische Vorstellungskraft (wie Nietzsche selbst), die eher an Pontius Pilatus als an Jesus erinnert. Um dies zu verstehen und darauf reagieren zu können, brauchen wir gute Ressourcen. In den letzten zwanzig Jahren im Leben Bavincks war Nietzsche wahrscheinlich sein häufigster Opponent. Wir würden davon profitieren, hier von Bavinck zu lernen.
Mehr hier: www.evangelium21.net.