Hat die Wissenschaft Gottes Tod bewiesen?
Hier ein kurzes englischsprachiges Video von Eric Metaxas zur Frage, ob die Wissenschaft Gott begraben hat:
Hier ein kurzes englischsprachiges Video von Eric Metaxas zur Frage, ob die Wissenschaft Gott begraben hat:
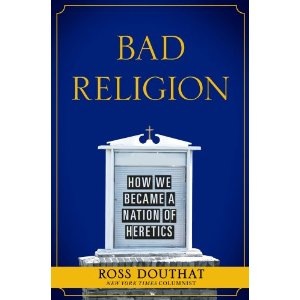 Das Buch Bad Religion: How We Became a Nation of Heretics des US-Publizisten Ross Douthat ist im Geiste von Chesterton geschrieben und hat in den USA eine heiße Debatte über Wesen und Auftrag der Kirche ausgelöst. Die New York Times hat ein Extrakt des Buches publiziert.
Das Buch Bad Religion: How We Became a Nation of Heretics des US-Publizisten Ross Douthat ist im Geiste von Chesterton geschrieben und hat in den USA eine heiße Debatte über Wesen und Auftrag der Kirche ausgelöst. Die New York Times hat ein Extrakt des Buches publiziert.
Tim Keller schreibt über Bad Religion:
Dieser Band ist ein nachhaltiger Beweis für Chestertons These, dass, wenn die Menschen sich von Gott abwenden, sie nicht an nichts, sondern an alles glauben.
Auch in Deutschland ist die Diskussion angekommen. ideaSpektrum schreibt:
Führen eine liberale Theologie und eine gesellschaftspolitische Ausrichtung der Kirchen zu ihrem Untergang? Über diese Frage ist eine Debatte in den USA entbrannt. Auslöser ist ein Artikel des Publizisten Ross Douthat in der New York Times (Ausgabe 14. Juli). Darin verweist er auf die Mitgliederverluste aller US-Traditionskirchen, etwa Anglikaner, Lutheraner, Reformierte, Methodisten, die sich einer liberalen Theologie verschrieben haben und Gesellschaftspolitik in den Vordergrund stellen.
Weiter heißt es dort:
Der evangelikale Bestsellerautor und Bonhoeffer-Biograf Eric Metaxas (New York) stimmt Douthats Analyse weitgehend zu. Er weist in der Internet-Zeitung Christian Post darauf hin, dass auch theologisch konservative Kirchen schrumpfen, etwa der Bund der Südlichen Baptisten – mit gut 16 Millionen Mitgliedern die größte protestantische Kirche in den USA. Aber nicht nur deshalb verbiete sich „klammheimliche Freude“ über den Niedergang der Traditionskirchen. Metaxas verweist auf einen Artikel des Theologen Timothy George, Vorsitzender der Colson-Zentrums in Lansdowne (Bundesstaat Virginia).
Wie er schreibt, seien auch die größten Kirchen in den USA – noch vor den Südlichen Baptisten die römisch-katholische Kirche mit 68,2 Millionen Mitgliedern – Versuchungen ausgesetzt, „das verblassende Ethos des liberalen Protestantismus nachzuahmen“. Oft würden evangelistische Gründe dafür angeführt: Man wolle „religiöse Kulturverächter“ durch eine Art „vager Neo-Spiritualität“ gewinnen. Die Absicht sei zwar ehrenhaft, aber die Folgen wahrscheinlich katastrophal: „ein soziales Evangelium, das allein sozial ist aber kein Evangelium“. Daraus entstehe ein Kirche, die nichts anderes mehr zu sagen habe, als das, was säkulare Eliten schon längst und meist besser gesagt hätten. George sieht die Gefahr eines „horizontalen Glaubens“, der das Zutrauen in Gottes erlösende Liebe verliere.
Die Diskussion um Metaxas Bonhoeffer sind inzwischen auch beim NDR angekommen. Daniel Kaiser schreibt:
Der fromme Bonhoeffer – das geht manchen Experten zu weit. Sie werfen Metaxas vor, den Theologen gewissermaßen entführt und aus ihm einen evangelikalen Christen gemacht zu haben. Kein Wunder also, dass das Buch dem Ex-Präsidenten George W. Bush so gut gefallen habe, ätzen sie. Der Biograf Metaxas bleibt dabei: Das Bonhoeffer-Bild der vergangenen Jahre sei falsch. „Es ist doch so, dass viele Gelehrte ihn gekapert und aus ihm fälschlicherweise einen weltlichen Humanisten und theologischen Linken gemacht haben“, sagt Metaxas. „Bei meinen Recherchen war ich geschockt, als ich herausfand: Das Gegenteil ist der Fall.“
Er sei nicht überrascht, dass Bonhoeffer-Experten, die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema befassen, einen Seiteneinsteiger wie ihn kritisierten. Er habe Bonhoeffer aber nicht in eine evangelikale Ecke stellen wollen, sondern „Bonhoeffer einfach zeigen, wie Bonhoeffer war“.
Mehr: www.ndr.de.
Immer wieder gehen Anfragen zum Bonhoeffer-Buch von Metaxas bei mir ein. Das erneute Auftreten des Biografen auf dem Willow Creek Deutschland-Kongress in Stuttgart beflügelt das Interesse. Idea meldet:
Bei Bonhoeffer könnten Gemeindeleiter lernen, im Vertrauen auf Gottes Wegweisung ihrer Berufung bis zum bitteren Ende treu zu bleiben, sagte Hybels. Er führte ein Podiumsgespräch mit dem Autor der Biografie „Bonhoeffer: Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet“, Eric Metaxas (New York). Dieser wandte sich dagegen, Bonhoeffer als liberalen Theologen darzustellen: „Je mehr ich nachforschte, desto mehr kam ich zu dem Ergebnis, dass diese Annahme Nonsens ist.“ Bonhoeffer habe die Bibel schon während seines Studiums anders verstanden als viele seiner Kommilitonen: „Für ihn war sie lebendig, sie spricht zu den Menschen. Er war einer der wenigen an der Fakultät, die ihre Stimme gegen die liberale Theologie erhoben haben.“ Hybels nannte Metaxas’ Bonhoeffer-Biografie eine unverzichtbare Ermutigung für Gemeindeleiter, die ihrer Berufung konsequent folgen wollen.
Ich möchte deshalb auf den älteren Beitrag „Der andere Bonhoeffer“ verweisen und kurz aus meiner Buchbesprechung zitieren, die im Magazin factum 8/2011 erschienen ist (S. 47):
Dass es gute Gründe dafür gibt, in Bonhoeffer einen unbequem orthodoxen Theologen zu sehen, haben z.B. Rainer Mayer oder Georg Huntemann mit ihren Veröffentlichungen zu Bonhoeffer gezeigt. Metaxas selbst erörtert Bonhoeffers Ringen um feste theologische Positionen angesichts der „mündig gewordenen Welt“ jedoch nur oberflächlich. Hier hätte ich mir eine gründlichere Auseinandersetzung mit dem Mann, „der doch noch das Erbe der liberalen Theologie in sich trägt“ (so B. am 3.8.1944 in einem Brief an Bethge), gewünscht. Auch evangelikale Autoren sollten die Gefahr eines „kreativen Missbrauchs“ Bonhoeffers nicht unterschätzen. Allerdings will Bonhoeffer: Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet keine theologische Abhandlung, sondern spannend geschilderte Lebensgeschichte sein. Diese Aufgabe hat Metaxas gemeistert. Hoffentlich werden viele Leser durch das Buch angeregt, sich gründlich mit Bonhoeffer auseinanderzusetzen.
Der Name Rudolf Bultmann taucht übrigens im Personenregister von Bonhoeffer: Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet nicht auf. Auch daran zeigt sich, dass die theologische Auseindersetzung mit Bonhoeffer vordergründig geblieben ist. Ferdinand Schlingensiepen schreibt in seiner Biografie kurz und präzise (Dietrich Bonhoeffer, 2010, S. 292–293):
Bonhoeffer hat sich, während er in Kieckow mit derart radikalen Gedanken beschäftigt war, die Zeit genommen, einen Vortrag zu lesen, den der Marburger Neutestamentier Rudolt Bultmann vor der neu gegründeten «Gesellschaft für Evangelische Theologie» gehalten hatte, und der seine Sprengkraft erst in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltet hat … Bultmanns Vortrag trug den Titel „Neues Testament und Mythologie“ und enthielt sein später von Theologen in der ganzen Welt diskutiertes Programm der „Entmythologisierung des Neuen Testaments“.
Bultmann vertrat die These, daß viele Berichte des Neuen Testaments, etwa die Himmelfahrt Christi, Mythen seien. Deren bis heute gültige Wahrheiten gelte es durch eine „existentiale Interpretation“ zu erschließen, nachdem man zuerst den unter der mythischen Einkleidung verborgenen überzeitlichen Wahrheitsgehalt aufgedeckt habe.
Während in Deutschland schon bald eine erste Welle heftiger Kritik einsetzte vor allem Hans Asmussen zeigte sich alarmiert –, urteilte Bonhoeffer zwar nicht unkritisch über Bultmanns faszinierendes Programm, aber er äußerte zuallererst Zustimmung. Öffentlich konnte er des Schreibverbotes wegen keine Stellung beziehen, indessen schrieb er an einen Schüler, der in Marburg im Lazarett lag:
„Ich gehöre zu denen, die [Bultmanns] Schrift begrüßt haben, … Grob gesagt: Bultmann hat die Katze aus dem Sack gelassen, nicht nur für sich, sondern für sehr viele (die liberale Katze aus dem Bekenntnissack), und darüber freue ich mich. Er hat gewagt zu sagen, was viele in sich verdrängen (ich schließe mich ein), ohne es überwunden zu haben. Er hat damit der intellektuellen Sauberkeit und Redlichkeit einen Dienst geleistet. Der Glaubenspharisäismus, der nun dagegen von vielen Brüdern aufgeboten wird, ist mir fatal. Nun muß Rede und Antwort gestanden werden. Ich spräche gern mit Bultmann darüber und möchte mich der Zugluft, die von ihm kommt, gern aussetzen. Aber das Fenster muß dann wieder geschlossen werden. Sonst erkälten sich die Anfälligen zu leicht.“