40. Todestag von Francis A. Schaeffer
Heute vor 40 Jahren erlag Francis A. Schaeffer nach langer Krankheit seinem Krebsleiden im Alter von 72 Jahren. Ich dem Buch Wahrheit und Liebe: Was wir von Francis Schaeffer lernen können (#ad) schrieb ich 2006 im Vorwort:
In seinen letzten Lebensjahren erinnerte Schaeffer an den klagenden Jeremia. Er war erschöpft und besorgt. Die schleichende Entertainisierung der Evangelikalen Bewegung hielt seiner Meinung nach die Christen davon ab, auf ernste Fragen seriöse Antworten zu geben. Die auch an den evangelikalen Ausbildungsstätten fortschreitende Relativierung der Aussagen der Heiligen Schrift hielt er für eine Tragödie mit vorhersehbaren Folgen. Schaeffer sah betroffen, dass die Verkündigung zu oft nicht durch einen heiligen und barmherzigen Lebensstil gedeckt war. Und es quälte ihn, dass so viele Gläubige auf die großen Herausforderungen in den Lebensrechtsfragen mit dem Rückzug in das bequeme Privatleben oder dem Aufbau ‚seliger Inseln‘ reagierten. Betend und sorgenvoll rief er der Gemeinde zu, auf die Heilige Schrift zu hören und den Gehorsam in der Lehre durch ein entsprechendes Leben zu dokumentieren.
Freundlicherweise haben die Schaeffer-Leser anlässlich des 40. Todestages Texte verfasst. Zunächst der Hinweis auf „40 Jahre nach Francis Schaeffer – was bleibt?“ von Jonas Erne. Uwe Brinkmann hat den Beitrag „Zum 40. Todestag von Francis A. Schaeffer (1912–1984) – eine persönliche Reflexion“ geliefert. Seine ehrlichen Erinnerungen sprechen mir aus dem Herzen:
Ich war gerade dabei, mein eigenes gemeindliches Erbe aufzuarbeiten, das von strenger Gesetzlichkeit geprägt war. In Francis Schaeffer fand ich jemand, der an „Bibeltreue“ den Altvorderen meiner kleinen Fraktion in nichts nachstand, aber gleichzeitig eine intellektuelle Weite ausstrahlte, die ich als echte Befreiung begriff.
Im Rückblick war er ein echter Rettungsanker in meinem intellektuellen Dilemma, die Bibel ernst nehmen zu wollen obwohl ich gleichzeitig mit einen Koffer voll ungelöster Fragen unterwegs war. Ohne die Hilfe von Schaeffer wäre ich wahrscheinlich in einer Sackgasse gelandet, oder hätte meinen ererbten Glauben ‚dekonstruiert‘, wie wir es 40 Jahre später, überall erleben.
Das jemand, der die Bibel ernst nahm und das Thema Weltmission und Gemeinde als Herzensanliegen verteidigte, sich gleichzeitig mit philosophischen Fragen beschäftigte und sich „sogar“ mit Fragen der Kunst und des Umweltschutzes auseinandersetzte … –, das war für mich geradezu unerhört. Francis Schaeffer wurde in meinen frühen 20-ern zu einer wahnsinnig starken Ermutigung, die ganze geschöpfliche Wirklichkeit als die eine Welt Gottes zu verstehen und mein Leben nicht in einen religiösen und weltlichen Teil aufzuspalten.
Das in seinem Vermächtnis von 1984 nachgedruckte „Kennzeichen des Christen“ hat mich tatsächlich zu Tränen gerührt, weil hier für mich die Spannung zwischen Einheit und Reinheit der christlichen Kirche – was mein traumatisches Metathema war – aufgearbeitet wurde: „Wer hat aber je von einer Konferenz gehört, die von der Frage bestimmt war, wie wahre Christen durch ihr Handeln Gottes Heiligkeit und gleichzeitig Gottes Liebe vor den Augen der Welt darstellen können? Wer hat je von Predigten oder Schriften gehört, die eingehend darlegen, wie man nach zwei Grundsätzen leben kann, die einander auszuschließen scheinen: 1.) nach dem Grundsatz der Reinheit der sichtbaren Kirche in Bezug auf Lehre und Wandel und 2.) dem Grundsatz der sichtbaren Liebe und Einheit unter allen wahren Christen?“
[#ad]
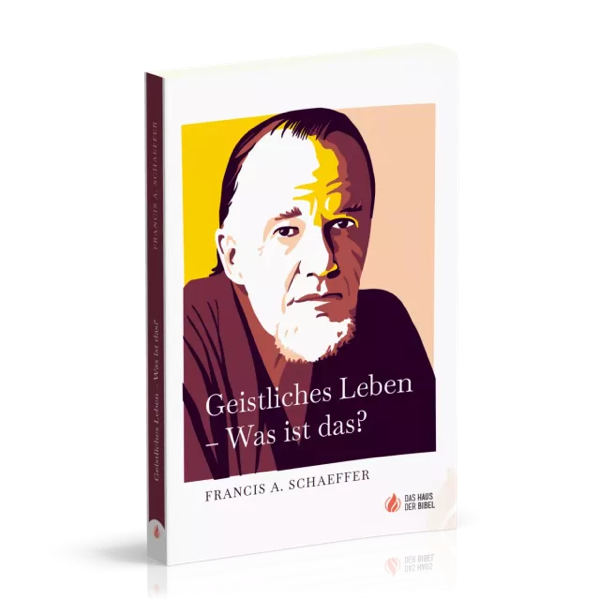 Das Haus der Bibel hat einige Bücher von Francis Schaeffer neu aufgelegt, darunter
Das Haus der Bibel hat einige Bücher von Francis Schaeffer neu aufgelegt, darunter