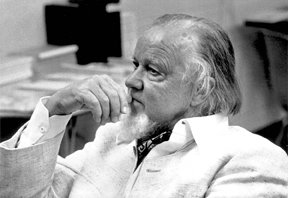Ich hoffe, irgendwann einmal eine Rezension zu Das Buch der Mitte (Basel: fontis Verlag, 2014) veröffentlichen zu können. Da ich das in diesem Jahr wegen anderer Verpflichtungen nicht mehr schaffe, will ich das Werk wenigstens kurz erwähnen.  Der Autor Vishal Mangalwadi ist ein indischer Philosoph, der durch Gottes Gnade Christ geworden ist. Im Buch der Mitte erzählt er lebendig, was er auf seiner eigenen Suche nach der Wahrheit erlebt hat. Zugleich webt er viele anspruchsvolle Themen in seine Erzählungen ein. Er zeigt anhand zahlreicher Beispiele, welch prägende Kraft die Bibel bei der Entstehung und Entwicklung Europas gehabt hat. Das Buch liest sich, was wir der Erzählweise des Autors und der guten Übersetzungsarbeit verdanken, sehr eingängig. Damit wir mal einen Eindruck bekommen, ein Beispiel. Zur Entstehung der unabhängigen Justiz schreibt Mangalwadi (S. 474–475):
Der Autor Vishal Mangalwadi ist ein indischer Philosoph, der durch Gottes Gnade Christ geworden ist. Im Buch der Mitte erzählt er lebendig, was er auf seiner eigenen Suche nach der Wahrheit erlebt hat. Zugleich webt er viele anspruchsvolle Themen in seine Erzählungen ein. Er zeigt anhand zahlreicher Beispiele, welch prägende Kraft die Bibel bei der Entstehung und Entwicklung Europas gehabt hat. Das Buch liest sich, was wir der Erzählweise des Autors und der guten Übersetzungsarbeit verdanken, sehr eingängig. Damit wir mal einen Eindruck bekommen, ein Beispiel. Zur Entstehung der unabhängigen Justiz schreibt Mangalwadi (S. 474–475):
Das Buch des Theologen Theodor von Beza (1519-1605) De iure magistratuum (dt. Über das Recht der Obrigkeiten) wurde 1573 veröffentlicht, ein Jahr nach Hotmans Buch und in Absprache mit ihm. Sein großes Thema ist die Unabhängigkeit der Justiz; es zählt zu den Originalquellen des Gedankens von der Unverletzlichkeit der Menschenrechte, der 200 Jahre später in der amerikanischen Bill of Rights (zehn Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten) Ausdruck fand. Vor Beza war in Europa allgemeiner intellektueller Konsens -vorgetragen von angesehenen Denkern wie Thomas von Aquin -, dass Könige nur von höherrangigen Personen, also entweder vom Kaiser oder vom Papst, abgesetzt werden konnten. Beza hingegen schuf eine biblische Basis dafür, dass die politische Macht in die Hände der rangniederen Beamten gelegt wurde, in die Hände der Richter. Er vertrat die Ansicht, die Richter und Beamten ständen nicht im Dienst des Königs, sondern seines Reiches. Folglich sei ihre vorrangige Aufgabe nicht, dem König zu dienen, sondern sich für das Wohl des Königreichs einzusetzen. Die amerikanische Idee des Amtsenthebungsverfahrens, wonach der Präsident vom Kongress angeklagt und seines Amtes enthoben werden kann, kommt aus Bezas Buch. Beza baute seine These auf der Aussage Hotmans auf, «… dass ein Volk auch ohne König existieren kann, während man sich einen König ohne Volk noch nicht einmal vorstellen kann».15 Aus Gottes Sicht geht es immer in erster Linie um das Volk. Gott knüpfte die Ämter von Königen und Obrigkeiten an klare Bedingungen – unter anderem an die Verpflichtung, dem Volk zu dienen. Gesetzt den Fall, ein König erteilte einen unrechtmäßigen Auftrag, einen unschuldigen Bürger zu töten, dann hätten die Richter das Recht und die Pflicht, dem König den Gehorsam zu verweigern, um Gott zu gehorchen und das Volk zu schützen. Der König sei wie ein Vasall seines Königreiches. Wenn er das Vertrauen missbrauche, habe er sein Amt verwirkt. Darüber hinaus, so argumentierte Beza auf der Basis der Konzile von Basel und Konstanz, hätten die Konzile auch das Recht, einen Papst abzusetzen, da Christus das wahre Oberhaupt der Kirche sei und nicht der Papst. Dieser bahnbrechende Gedanke protestantischer Ethik führte später dazu, dass die Unfehlbarkeit der Päpste hinterfragt wurde. Westliche Gelehrte mögen die grundlegende Rolle Bezas für die Prägung des politischen Denkens in Europa ignorieren, dennoch profitieren alle im Westen von seinem Erbe – dem Prinzip der unabhängigen Justiz.
Leser, die mit den Büchern von Francis Schaeffer vertraut sind, werden schnell merken, dass Mangalwadi in einem verwandten Geiste schreibt. Tatsächlich ist Mangalwadi von Schaeffer und von L’abri geprägt. Ranald Macaulay, Schwiegersohn von Edith und Francis Schaeffer, schreibt denn auch über das Buch: „Seit dem Buch von Francis Schaeffer, Wie können wir denn leben? wurde uns keine solch übersichtliche und weitreichende Entfaltung der Probleme unseres globalen Gemeinwesens mehr nahegebracht.“ Mangalwadi steht für eine biblisch fundierte „transformative Theologie“, die sich von ideologisch aufgeladenen „Theologien der Hoffnung“ erfrischend absetzt und die Zentralität von Bibel und Evangelium betont. Der Verlag schreibt über das Buch:
Als Buch der Bücher wurde die Bibel aus der Mitte gedrängt. Sola scriptura – «allein die Schrift», lehrte einst Martin Luther. Aber die Reformation ist lange her, und längst haben andere Kräfte ihren Alleinstellungsanspruch in den Ring geworfen. Dieser Verlust der Mitte ist heute mit Händen zu greifen. Vishal Mangalwadi hat genau das großartig dokumentiert. Vor allem aber konzentriert er sich auf die Epochen der Gravitationskraft der Bibel, die über Jahrhunderte hinweg immer wieder Menschen inspirierte und Kultur erschuf. Ob Menschenrechte, technologischer Fortschritt, Musik, Architektur oder Demokratie-Entwicklung: Immer stand die kulturprägende Kraft der Bibel jenen Menschen zur Seite, die die Welt mit neuen Innovationen beschenkten. «Das Buch der Mitte» ist das seltene und glückliche Zusammenkommen von lebendiger Erzählung, nüchterner Beweisführung und überraschenden Einsichten, die uns den Schatz der Bibel wieder vor Augen führen und zerrissene Landkarten wieder zusammensetzen. Ein Muss für sprachfähige Christen.
Ich kann mich dem Votum nur anschließen. Ein herzliches Dankeschön an den Verlag fontis und die Übersetzer dafür, dass sie das recht umfängliche Projekt mit über 600 Seiten in Angriff genommen haben! Ich wünsche dem Buch eine weite Verbreitung. Vielleicht sucht der ein oder andere ja noch ein Geschenk für das Weihnachtsfest? Das Buch der Mitte ist ein wunderbares Präsent für Menschen, die auf der Suche sind. Es hilft darüber hinaus Zweiflern oder Verantwortlichen in der Jugend- und Studentenarbeit. Profitieren werden auch Christen, die sich von Kunst und Kreativität angezogen fühlen und in ihrem Umfeld wenig Verständnis dafür ernten. Pastoren können von dem Buch ebenfalls einen Nutzen ziehen, macht der Autor doch deutlich, wie wichtig die Botschaft der Heiligen Schrift für das gesamte Leben ist. Abschließend noch ein kurzes Video, indem Vishal Mangalwadi sein Buch vorstellt:

 Als Schlüsselbegriff Schaeffers nennt Edgar die „Wirklichkeit“ (reality). Es besteht eine objektive Wahrheit der Welt und ihres Schöpfers. Ebenso ist die Existenz des Bösen Wirklichkeit. Immer wieder greift Schaeffer auf den Vergleich mit den beiden Stühlen zurück. Für den Nichtchristen gibt es nur die sichtbare Wirklichkeit (der eine Stuhl), für den Christen ist jedoch die unsichtbare Wirklichkeit (der zweite Stuhl) ebenso real. Leider verhalten sich manche Christen so, als ob es nur einen Stuhl gäbe. Die Freiheit des Christen ist Ausdruck der Realität, die sich zuerst in seinem Innern abbildet. Sie lässt sich, wie Schaeffer am Anfang von „True Spirituality“ aufzeigt, auf zweifache Art überprüfen: Ob wir eine tiefe Befriedigung in Gott finden und ob wir unsere Nachbarn lieben. Der Tod und die Auferstehung Christi bilden die Basis der Wirklichkeit des christlichen Lebens. Im zweiten Teil des Buches „True Spirituality“ wendet Schaeffer diese Realität auf die durch die Sünde entstellten Beziehung des Menschen zu sich selbst und anderen (Ehe, Kirche) an. Die Realität von Christi Wirken triumphiert über die Sünde. Dies zeigt sich etwa bei körperlichen oder psychischen Problemen nicht in einer vollständigen, sondern einer substanziellen Heilung.
Als Schlüsselbegriff Schaeffers nennt Edgar die „Wirklichkeit“ (reality). Es besteht eine objektive Wahrheit der Welt und ihres Schöpfers. Ebenso ist die Existenz des Bösen Wirklichkeit. Immer wieder greift Schaeffer auf den Vergleich mit den beiden Stühlen zurück. Für den Nichtchristen gibt es nur die sichtbare Wirklichkeit (der eine Stuhl), für den Christen ist jedoch die unsichtbare Wirklichkeit (der zweite Stuhl) ebenso real. Leider verhalten sich manche Christen so, als ob es nur einen Stuhl gäbe. Die Freiheit des Christen ist Ausdruck der Realität, die sich zuerst in seinem Innern abbildet. Sie lässt sich, wie Schaeffer am Anfang von „True Spirituality“ aufzeigt, auf zweifache Art überprüfen: Ob wir eine tiefe Befriedigung in Gott finden und ob wir unsere Nachbarn lieben. Der Tod und die Auferstehung Christi bilden die Basis der Wirklichkeit des christlichen Lebens. Im zweiten Teil des Buches „True Spirituality“ wendet Schaeffer diese Realität auf die durch die Sünde entstellten Beziehung des Menschen zu sich selbst und anderen (Ehe, Kirche) an. Die Realität von Christi Wirken triumphiert über die Sünde. Dies zeigt sich etwa bei körperlichen oder psychischen Problemen nicht in einer vollständigen, sondern einer substanziellen Heilung.