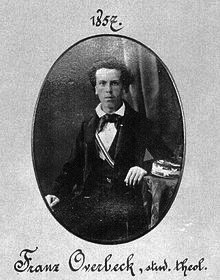Kultur des Todes (10): Stirb zur rechten Zeit, lehrte es Zarathustra
Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Wucht der Geist des Zarathustra letzte Rückbindungen an das christliche Erbe in Europa durchschneidet. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt nun in einem Grundsatzurteil die geschäftsmäßige Sterbehilfe. Es gebe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, und dieses Recht schließe „die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen – in jeder Phase menschlicher Existenz“ (siehe hier).
Nietzsche würde jubeln. Er schrieb in seinem Zarathustra: „Noch klingt fremd die Lehre: ‚stirb zur rechten Zeit!‘“. Jetzt ist diese Lehre auch in Deutschland Gesetz. Nietzsche machte das Christentum für die Verneinung des Lebens verantwortlich. Unsere Kultur bejaht im Namen des Lebens den Tod.
Hier Nietzsche im Kontext ( Also sprach Zarathustra, KSA, Bd. 4, 1999, S. 93–94):
Viele sterben zu spät, und Einige sterben zu früh. Noch klingt fremd die Lehre: „stirb zur rechten Zeit!“
Stirb zur rechten Zeit; also lehrt es Zarathustra.
Freilich, wer nie zur rechten Zeit lebt, wie sollte der je zur rechten Zeit sterben? Möchte er doch nie geboren sein! – Also rate ich den Überflüssigen.
Aber auch die Überflüssigen tun noch wichtig mit ihrem Sterben, und auch die hohlste Nuß will noch geknackt sein.
Wichtig nehmen Alle das Sterben: aber noch ist der Tod kein Fest. Noch erlernten die Menschen nicht, wie man die schönsten Feste weiht.
Den vollbringenden Tod zeige ich euch, der den Lebenden ein Stachel und ein Gelöbnis wird.
Seinen Tod stirbt der Vollbringende, siegreich, umringt von Hoffenden und Gelobenden.
Also sollte man sterben lernen; und es sollte kein Fest geben, wo ein solcher Sterbender nicht der Lebenden Schwüre weihte!
Also zu sterben ist das Beste; das zweite aber ist: im Kampfe zu sterben und eine große Seele zu verschwenden.
Aber dem Kämpfenden gleich verhaßt wie dem Sieger ist euer grinsender Tod, der heranschleicht wie ein Dieb – und doch als Herr kommt.
Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will.
Noch 1975 hießt es im Katechismus der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands:
Nach christlicher Auffassung hat der Mensch kein Recht zu einem solchen zerstörerischen Eingriff (dem Selbstmord), da er sich das Leben auch nicht selbst gab, sondern mit seinem Lebensauftrag von Gott geschenkt bekam.
Ich bin ja fast schon überrascht (und erfreut), dass die beiden großen Kirchen das heutige Urteil kritisch sehen und erklären:
„Mit großer Sorge haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Bundesverfassungsgericht am heutigen Tag (26. Februar 2020) das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB) aufgehoben hat. Dieses Urteil stellt einen Einschnitt in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur dar. Wir befürchten, dass die Zulassung organisierter Angebote der Selbsttötung alte oder kranke Menschen auf subtile Weise unter Druck setzen kann, von derartigen Angeboten Gebrauch zu machen. Je selbstverständlicher und zugänglicher Optionen der Hilfe zur Selbsttötung nämlich werden, desto größer ist die Gefahr, dass sich Menschen in einer extrem belastenden Lebenssituation innerlich oder äußerlich unter Druck gesetzt sehen, von einer derartigen Option Gebrauch zu machen und ihrem Leben selbst ein Ende zu bereiten.
Bonhoeffer hatte das gut durchschaut. Durch das „Ja“ zum Selbstmord wird verleugnet, dass Gott lebt (Ethik, Werke, Bd. 6, S. 194):
Gott hat sich das Recht über das Ende des Lebens selbst Vorbehalten, weil nur er weiß, zu welchem Ziel er das Leben führen will. Er allein will es sein, der ein Leben rechtfertigt oder verwirft. Vor ihm wird Selbstrechtfertigung zur Sünde schlechthin und darum auch der Selbstmord. Es gibt keinen anderen zwingenden Grund, der den Selbstmord verwerflich macht als die Tatsache, daß es über dem Menschen einen Gott gibt. Diese Tatsache wird durch den Selbstmord geleugnet.