Augustinus: Gottes Gerechtigkeit ist mit seiner Güte vereinbar

Auf Anfrage des karthagischen Diakons Quodvultdeus verfasste Augustinus parallel zu seinen berühmten Retractationes in den Jahren vor seinem Tod einen sogenannten „Häretikerkatalog“, in dem er insgesamt 88 Gruppierungen unter dem Oberbegriff der Häresie klassifizierte und beschrieb.
Vanessa Bayha hat in ihrer im Wintersemester 2022/21 von der Theologischen Fakultät der Universität Tübingen angenommenen Dissertation diesen augustinischen Häretikerkatalog fortlaufend kommentiert. Dabei rückt Augustins spezifische Kenntnis der jeweiligen Gruppierungen vor dem Hintergrund seines eigenen antihäretischen Engagements und seines Gesamtwerks sehr gut in den Blick. Die Untersuchung wirft ein Schlaglicht auf so gut wie alle Kontroversen, in denen Augustinus zeitlebens verwickelt war.
Der Beitrag in haer. 21 im Häretikerkatalog lässt deutlich erkennen, dass sich Augustinus sowohl gegen die Manichäer als auch gegen die Pelagianer für die Einheit im Gottesbild sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments aussprach.
Ich zitiere aus (#ad): Bayha, V., Augustins „De haeresibus“: Ein Kommentar, Paderborn: Brill Schöningh, 2023, S. 150–151:
Irenäus, auf den die Vorlage für haer. 21,2–4 zurückgeht, hält gegen gnostische Tendenzen, Gottes Gerechtigkeit und Güte als unvereinbar zu betrachten, Gott als den Ursprung der Gerechtigkeit fest. Gottes iustitia manifestiert sich demnach sowohl in der Gabe des alttestamentlichen Gesetzes als auch in der Inkarnation Jesu Christi. Augustins Argumentation bezüglich des deus iustus ist allem voran gegen Manichäer und Pelagianer ausgerichtet; so verteidigt er gegen erstere besonders die Gerechtigkeit des alttestamentlichen Gottes und hält gegen letztere fest, dass Gott auch dann gerecht ist, wenn er einige nicht erwählt. Gegen die manichäische Behauptung, die göttliche Natur sei nicht vollkommen gut, setzt Augustin iustitia diuina [sic ?]und bonitas dei konstitutiv in eins; in der pelagianischen Kontroverse werden entsprechend iustitia und caritas dei parallelisiert. Für die Interpretation von haer. 21,3 hat dies zur Folge, dass die Alternative bonus oder iustus in ihrer Applikation auf den Gott des Gesetzes und der Propheten Augustin zufolge im Grundsatz verfehlt ist. Für Augustin gibt es nur einen Gott, der in beiden Testamenten bezeugt wird, den er als summum bonum bekennt und den er in der Konfrontation mit der manichäischen Zurückweisung des Gesetzes und des Alten Testaments verteidigt. Im Zuge dieser Verteidigung der Einheit im Gottesbild beider Testamente hält Augustin auch an der Güte und Gerechtigkeit des Gesetzes und an der Kontinuität zwischen dem mosaischen Gesetz und der lex Christi als Manifestationen des einen Gotteswillens fest. Christus gilt demzufolge als Geber des neuen Gesetzes und auch die Entsprechung zwischen der „lex, quae per Moysen data est“ und der „gratia et ueritas per lesum Christum facta“ wird im Zuge des übergreifenden Schemas von Verheißung und Erfüllung interpretiert. Entsprechend der paulinischen Gesetzesvorstellung hält Augustin fest, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut sei (vgl. Röm 7,12), insofern es dem Menschen das Gute bekannt macht und einen Weg zu seiner Erfüllung aufzeigt. Im Zusammenhang der pelagianischen Kontroverse arbeitet Augustin sein Gesetzesverständnis weiter aus, wobei die positive Funktion des Gesetzes per se bestehen bleibt, da es denjenigen zur Gerechtigkeit dient, die es erfüllen. Durch das Kommen Christi bleibt die lex in Geltung; eine Neuerung findet im Menschen statt, der kraft göttlicher Gnade in den Stand versetzt wird, der eine Gesetzeserfüllung möglich macht In De spiritu et littera wird diese Wechselbeziehung zwischen lex und gratia deutlich, wenn Augustin etwa formuliert: „lex ergo data est, ut gratia quaereretur, gratia data est, ut lex impleretur“. Wenngleich Augustin zufolge die Konfrontation des Menschen mit seiner Unfähigkeit, das Gesetz zu erfüllen, durch das Zuteilwerden der Christusgnade vollkommen übergipfelt wird, appliziert er den Begriff der lex auf beide Zusammenhänge, wenn er der lex operum die lex fidel gegenüberstellt und somit betont, dass der Maßstab der Gerechtigkeit kontinuierlich in Geltung steht. Die gnadenhafte Restitution der Beziehung zwischen Gott und Mensch in Christus kann wiederum mit dem Terminus der iustitia beschrieben werden. Somit ist letztlich die verfehlte Antithese zwischen bonus und iustus nicht nur für haer. 21,3 aufzuheben, vielmehr wäre die Einheit beider Attribute nach Augustin auch dem pater Christi (vgl. haer. 21,4) zuzuschreiben.
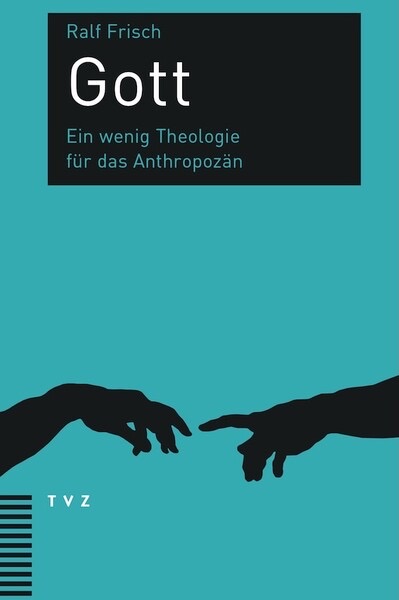
 D.A. Carsons Buch Die komplexe Lehre von der Liebe Gottes ist nun endlich auch in deutscher Sprache erhältlich. Das Buch geht auf Vorträge zurück, die Carson im Februar 1998 am Dallas Theological Seminary gehalten hat. Erörtert werden Fragen wie: Kann Gott angesichts seiner Unveränderlichkeit Gefühle haben? Wie verhält sich die Liebe Gottes zu seiner Souveränität und zu seinem Zorn?
D.A. Carsons Buch Die komplexe Lehre von der Liebe Gottes ist nun endlich auch in deutscher Sprache erhältlich. Das Buch geht auf Vorträge zurück, die Carson im Februar 1998 am Dallas Theological Seminary gehalten hat. Erörtert werden Fragen wie: Kann Gott angesichts seiner Unveränderlichkeit Gefühle haben? Wie verhält sich die Liebe Gottes zu seiner Souveränität und zu seinem Zorn? In diesem Interview habe ich mit Alexander Reindl, dem Geschäftsführer von Evangeliums21, über
In diesem Interview habe ich mit Alexander Reindl, dem Geschäftsführer von Evangeliums21, über