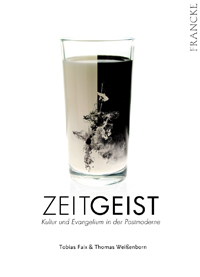Blindes Klammern an Kontextualisierung
David Helm beschreibt sehr schön, was passiert, wenn wir die Kontextualisierung zu weit treiben:
Ein blindes Klammern an Kontextualisierung verändert unser Predigen in mindestens drei Bereichen – und niemals zum Besseren. Erstens: Es beeinträchtigt unsere Perspektive beim Studium, sodass der Prediger sich in der Vorbereitung auf seine Predigt mehr mit der Welt als mit Gottes Wort beschäftigt. So etwas bezeichne ich als impressionistisches Predigen. Zweitens: Blindes Klammern an Kontextualisierung verändert unseren Gebrauch der Kanzel: Das Wort Gottes soll dabei eher unsere enthusiastischen Pläne und Vorhaben unterstützen als die Pläne Gottes. Das nenne ich berauschtes Predigen. Und drittens: Es verschiebt unsere Sicht von Autorität. Die so „erfrischende“ und „durch den Geist geführte“ supergeistliche Lesart des Predigers wird maßgeblich für die Wahrheit. Das nenne ich inspiriertes Predigen. So manche Predigt, die wir als auslegend bezeichnen würden, wird dadurch in Wirklichkeit das Ziel verfehlen.
Mehr: www.evangelium21.net.
 Nächste Woche erscheint Tim Kellers neues Buch:
Nächste Woche erscheint Tim Kellers neues Buch: