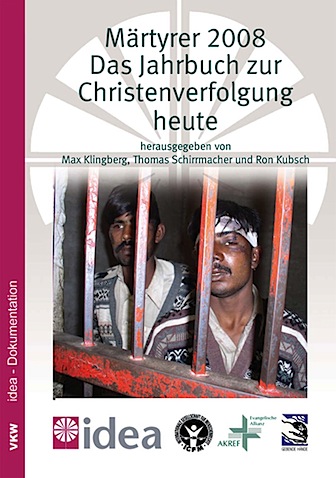Josef Jäger, ein Kollege aus dem Arbeitskreis für Religionsfreiheit und Menschenrechte der Evangelischen Allianz, hat freundlicherweise folgenden Bericht der Weltweiten Evangelischen Allianz über die Situation der Christen in Zimbabwe übersetzt.
Zimbabwe: »Wir werden verfolgt«
»Religionsfreiheit« nur für Angehörige der Staatsreligion ist keine Religionsfreiheit. »Religionsfreiheit«, die keinen Religionswechsel erlaubt, ist keine Religionsfreiheit. Genau so wenig ist eine »Religionsfreiheit«, die von der politischen Loyalität zu einer bestimmten Partei abhängig gemacht wird, echte Religionsfreiheit.
Was 2001 als Einmischung der Regierung in die Angelegenheiten der anglikanischen Kirche in Zimbabwe begonnen hat, hat sich zu schwerwiegenden Verstößen gegen die Religionsfreiheit entwickelt, die so weit gehen, dass sich »Dissidenten« unter den Anglikanern, und das sind die meisten der Anglikaner in der Hauptstadt Harare, nur noch unter Lebensgefahr versammeln können. Und es spricht nichts dafür, dass die Unterdrückung und Verfolgung bei den Anglikanern von Harare ein Ende hat. Auch die katholische Kirche und verschiedene protestantische Organisationen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, haben den Hass des Regimes bereits zu spüren bekommen.
In Harare wurden tausende Anglikaner aus den Kirchen ausgesperrt? Warum? Weil die anglikanische Kirche den Mut und die Integrität hatte, sich dem von Mugabe eingesetzten korrupten Bischof Dr. Nolbert Kunonga zu widersetzen. 2001 hatte die Geheimpolizei die Bischofswahl zugunsten von Kunonga beeinflusst. Kunonga hatte in den USA Theologie der Befreiung am „Unification Seminary“ der Vereinigungskirche von Rev. Sun Myung Moon in Barrytown im Bundesstaat New York gelehrt. Sein aussichtsreicher Gegenkandidat Tim Neill hatte sich beim Regime unbeliebt gemacht, da er dessen Menschenrechtsverletzungen anprangerte. Ein Beispiel für die Einschüchterung dieses an der Universität Oxford ausgebildeten Theologen: er erhielt einen Brief einer Regierungsstelle, in dem er gewarnt wurde, er würde sich um einen »Reisepass in die Hölle« bewerben. Kunonga begann nach seiner Ernennung zum Bischof, die Diözese in einen religiösen Arm der Regierungspartei ZANU-PF umzuwandeln. Er vertrieb die weißen Priester und »säuberte« die Priesterschaft von allen, die nicht als regimetreu galten. Das führte dazu, dass die Hälfte der afrikanischen Priester ins Ausland flohen. Um die verwaisten Kanzeln zu besetzen, begann er Personen ohne theologische Ausbildung zu Priestern zu ordinieren, darunter auch Mitglieder der Geheimpolizei. 2003 wurde der Fall von Bischof Kunonga vor ein Kirchengericht gebracht, und zwar wegen mehrerer Annklagepunkte von Häresie und Betrug bis zur Anstiftung zum Mord an zehn Priestern, die seiner Linie nicht folgen wollten. Das Verfahren vor dem Kirchengericht konnte nicht abgeschlossen werden, da die im Ausland befindlichen Zeugen aus Furcht um ihr Leben nicht nach Zimbabwe zurückkehren wollten, um auszusagen. Doch Kunonga hatte seinen Einfluss bereits verloren. Zuletzt versuchte er, die Diözese Harare von der Kirchenprovinz Zentralafrika – einer Gruppe von Diözesen in Botswana, Malawi, Sambia und Zimbabwe – herauszulösen, um seine Position zu erhalten. Gläubige und Priester wandten sich von ihm ab. Der politisch motivierte Spaltungsversuch scheiterte.
Daraufhin setzte die anglikanische Kirche der Kirchenprovinz Zentralafrika Kunonga wegen des Versuchs der Kirchenspaltung als Bischof von Harare ab. Dr. Sebastian Bakare, der 66-jährige ehemalige Bischof von Manicaland (Region an der Grenze zu Mozambique) wurde aus dem Ruhestand geholt, um Kunongas Position als Bischof von Harare zu übernehmen. Kunonga focht die Entscheidung vor einem weltlichen Gericht (Harare High Court) an. Dieses gestand der anglikanischen Kirche jedoch das Recht zu, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln, bestimmte aber, dass die beiden die Kathedrale teilen sollten. Kunonga widersetzte sich und verbarrikadierte sich mit etwa 40 Jugendmilizionären der ZANU-PF in der Kathedrale. Anfang Mai wies der Oberste Gerichtshof die Berufung Kunongas ab. Bei aller Gesetzlosigkeit und dem bedrohlichen Klima im Land ist dies eine mutige Entscheidung der Höchstrichter, die damit bereit sind, sich auch dem Zorn Mugabes auszusetzen.
Kunonga wurde inzwischen von der Kirchenprovinz Zentralafrika der Anglikanischen Kirche exkommuniziert.
Explodierende Gewalt
Seither ist es zu einer Explosion staatlich angezettelter Gewalt gegen die Anglikaner von Harare gekommen. Mugabes Polizei hat alle Kirchen und kirchlichen Grundstücke beschlagnahmt und »Dissidenten« unter den Anglikanern zu Verrätern gestempelt. In einer Schilderung eines Übergriffs am 16. Mai (Bericht New York Times) heißt es: »Die Gläubigen standen aufgereiht zur Heiligen Kommunion, als die Polizei die große St. Franziskuskirche in Harare, der Hauptstadt Zimbabwes, stürmte. Helm tragende Polizisten mit schwarzen Stiefeln schlugen mit ihren Schlagstöcken gegen die Kirchenbänke, während verängstigte Gottesdienstbesucher zu den Toren drängten. Ein Polizist schwang seinen Schlagstock in gefährlichen Bögen und traf alte Frauen, ein Mädchen und eine Großmutter, die gerade ihre Bibel aufheben wollte. Eine einzelne Frau begann aus einem Kirchenlied in der Shone Sprache zu singen: ›Wir werden Gott anbeten, egal welche Prüfungen uns begegnen!‹ Hunderte Frauen stimmten ein.«
In der St. Paulskirche in Highfield, einem Außenbezirk von Harare, weigerten sich die Gläubigen, zu gehen und sangen weiter »Gloria in Excelsis De«, als am 4. Mai ungefähr ein Dutzend Polizisten in die Kirche eindrangen. Der Kommandant funkte nach Verstärkung. Etwa 50 Polizisten vertrieben dann einige hundert Gläubige durch Lärm, indem sie mit ihren Schlagstöcken gegen die Kirchenbänke schlugen. Einige Gläubige photographierten die Polizisten mit ihren Handys. Nachdem die Polizei auf einige Gottesdienstbesucher eingeschlagen hatte, wurde ihnen gesagt: »Geht nach Hause, ihr habt hier nichts zu suchen«.
Bischof Bakare erklärte: »Als Theologe, der viel über die Verfolgung der ersten Christen gelesen hat, fühle ich mich wirklich verbunden mit ihrer Geschichte. Wir werden verfolgt.«
Bischof M. Thomas Shaw von der Episkopalkirche aus Massachusetts hat kürzlich Zimbabwe besucht. Auch er berichtet über Kirchenschließungen, Verhaftungen, konfiszierte Konten und Fahrzeuge der anglikanischen Kirche. Die Einheimischen berichteten ihm über Polizeigewalt, Schläge, Einkerkerung und Einschüchterung durch Polizeihunde als alltägliche Elemente im Leben der Anglikaner von Harare. Bischof Shaw erlebte einen Gottesdienst am 18. Mai, den die Polizei aufzulösen versuchte. Die Menschen weigerten sich zu gehen, obwohl die Atmosphäre sehr bedrohlich war. Sie blieben, beteten und sangen mehr als 2 Stunden lang, während die Polizei sie bedrohte und gegen die Bankreihen schlug. Es waren auch Polizeihunde vor Ort. Weiter berichtet er: »Am Sonntag ging ich in dieses arme Stadtviertel. Es waren ungefähr 400 Menschen zum Gottesdienst in einem Hof eines Privathauses versammelt. Die Reihen reichten bis auf die Straße. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Die Freude und Begeisterung dieser Leute ist wirklich tief gehend.«
Weiter kompliziert wird die Situation der Christen durch ein seit Mitte Mai in Kraft befindliches Verbot von öffentlichen Versammlungen, darunter auch Gebetsversammlungen. Dies betrifft alle Konfessionen. Pastor Useni Sibanda von der Vereinigung der Kirchen von Bulawayo, erklärte gegenüber dem ökumenischen Nachrichtendienst Ecumenical News International: »Letzte Woche haben sie uns gesagt, dass die Kirchen keine Gebetsversammlungen im Freien mehr abhalten dürfen, außer auf dem Kirchengelände. Das ist schwer einzuhalten, wenn wir aus unseren Kirchen ausgesperrt sind.«
In den letzten Wochen hat die Polizei Razzien in Büros von Menschenrechtsorganisationen und christlichen Organisationen durchgeführt, darunter auch bei der christlichen Allianz Zimbabwes, der christlichen Studentenbewegung von Zimbabwe und der ökumenischen Organisation Ecumenical Support Services. Dabei wurden einige Personen festgenommen. Doch der Generalstaatsanwalt weigerte sich, die Verhafteten anzuklagen. So wurden sie wieder freigelassen.
Die Kirche im Schatten des Kreuzes
Anfang Juni haben die anglikanischen Bischöfe der Provinz Zentralafrika eine Pastoralbotschaft veröffentlicht, in der sie ihre tiefe Sorge und Bestürzung über die Eskalation der Gewalt zum Ausdruck bringen und die Gewalttäter aufrufen, das Gesetz zu respektieren.