Die Erziehungswissenschaftler Bernd Ahrbeck und Marion Felder haben heute in der FAZ einen wichtigen Artikel mit dem Titel: „Die klassische Familie wird zum Ausnahmefall: Politisch Verantwortlichen fehlt der Mut zum Widerspruch gegen die Transgenderpropaganda in Kindertagesstätten und Kindergärten“ publiziert (03.09.2020, Nr. 205, S. 8). Ausgangspunkte für ihre Sorgenschrift ist der „Equality Act“, der kürzlich in den USA vorgelegt wurde. Der versteht sich als Bürgerrechtsgesetz und soll jegliche Art von Diskriminierung verhindern. „Gender Identity“ und „sexuelle Orientierung“ spielen darin eine gewichtige Rolle. „Bereits in einem sehr jungen Lebensalter sollen Kinder frei über ihre Gender-Identität entscheiden. Also auch darüber, ob sie abweichend zum biologischen Geschlecht angesprochen werden wollen, Hormone nehmen und sich operativ umwandeln lassen möchten. Das sei ihr elementares Recht, das ihnen niemand nehmen dürfe, auch die Eltern nicht – so lautet der Kern des Gesetzes.“
Die Autoren sprechen dann die Entwicklungen in Deutschland an und beklagen, dass eine pädagogische „Elite“ hier inzwischen die Trends setzt, und zwar bereits in den Kindertagesstätten und Schulen. „Es geht in erster Linie nicht mehr darum, dass bestehende Diskriminierungen abgebaut werden“, schreiben sie. „Das Gleichheitsstreben dient inzwischen ganz anderen Zwecken. Ziel ist die Vergewisserung und Bestätigung, dass bestimmte Sexualitäts- und Lebensformen im besonderen Maße fortschrittlich, human und aufgeklärt sind“, heißt es weiter.
Und dann können wir nachlesen, was Sexualpädagogen den Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern heute zumuten:
Die LGBTQ-Bewegung schreitet gemeinsam mit Sexualpädagogen wie Sielert, Timmermanns oder Tuider voran, die sich als pädagogische Avantgarde verstehen. In Tuiders einschlägigem Standardwerk „Sexualpädagogik der Vielfalt“ werden dreizehnjährige Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, Praktiken wie Analsex als Theaterstück darzustellen. Fünfzehnjährige sollen einen „Puff für alle“ beziehungsweise ein „Freudenhaus der sexuellen Lebenslust“ bis ins Detail hinein gestalten, damit sie für „marginalisierte Lebensformen“ und „sexuelle Vorlieben“ sensibilisiert werden. Vierzehnjährige sollen diverse Gegenstände wie Dildos, Vaginalkugeln, Potenzmittel, Handschellen, erotische Geschichten, Aktfotos, Lack/Latex oder Leder den unterschiedlichsten Personengruppen eines Miethauses zuordnen, wobei heterosexuelle Paare mit Kindern interessanterweise nicht vorkommen. Kinder sind dadurch Themen und Inhalten ausgesetzt, die altersinadäquat sind, die sie überfordern, irritieren und befremden.
Es heißt weiter: „Heterosexualität und die klassische Familie werden inzwischen in eine Randposition gedrängt. Sie gelten fast schon als etwas Exotisches, das sich besonders legitimieren muss. Judith Butlers Rede von der Heterosexualität als Zwangsheterosexualität steht unwidersprochen im Raum, ebenso wie ihr dezidierter Wunsch, eine Geschlechterverwirrung herbeizuführen. Das sollte zu denken geben. Damit gerät jene Lebensform in Verruf, die von der großen Bevölkerungsmehrheit als stimmig und für sich passend erlebt und gelebt wird.“
Bernd Ahrbeck und Marion Felder bedauern, dass die Politik diese Entwicklung einfach so hinnimmt: „Hier fehlt es an Mut zu entschiedenem Widerspruch, auch von politisch verantwortlicher Seite.“
Unbedingte Leseempfehlung!

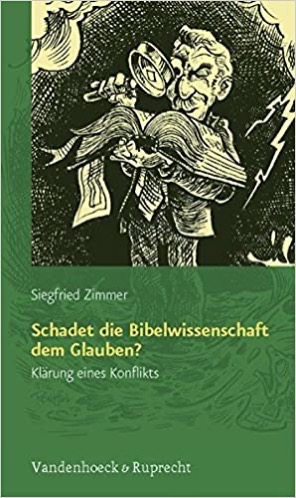 Warum man die Bibel mit gutem Wissen und Gewissen anders lesen kann als Siegfried Zimmer, beschreibe ich in dem Artikel „Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?“. Darin heißt es:
Warum man die Bibel mit gutem Wissen und Gewissen anders lesen kann als Siegfried Zimmer, beschreibe ich in dem Artikel „Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?“. Darin heißt es: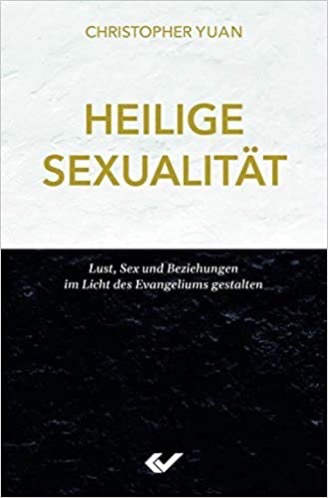 Jonathan Steinert hat für das christliche Medienmagazin pro das neue Buch
Jonathan Steinert hat für das christliche Medienmagazin pro das neue Buch