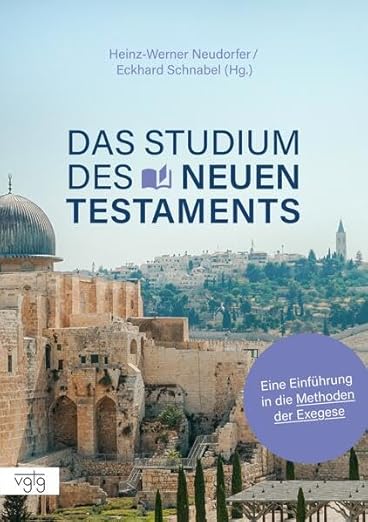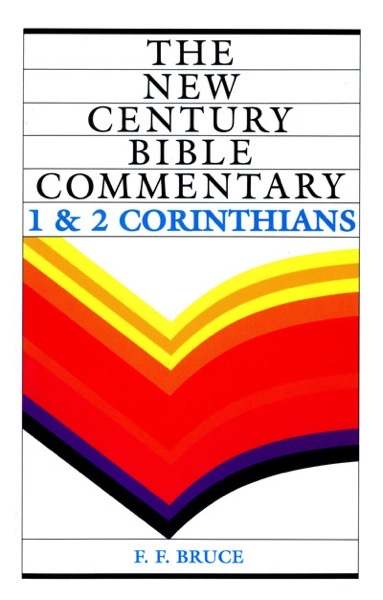Licht und Schatten von Weihnachten
Daniel Knoll schreibt über „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens“ (Lk 2,14, in: Herold, Nr. 12, Dez. 2024, S. 4–5):
Wie kann man denn sagen: Es gibt Freude für alle, aber den Grund für diese Freude – nämlich den Frieden – gibt es nicht für alle? Das klingt in etwa so, wie wenn plötzlich in einem Gefangenenlager laut und für alle hörbar angekündigt wird: „Es gibt einige unter euch, die begnadigt werden.“ Diese Ankündigung löst eine große Freude aus, denn jeder der Gefangenen hofft, zu den Begnadigten zu gehören. Doch nur für einige wird diese Hoffnung letztlich zur frohen Gewissheit.
Das ist eigentlich das Drama von Weihnachten. Alle freuen sich über Weihnachten, aber nicht alle haben einen Grund dazu. Alle freuen sich über die Friedensbotschaft, doch nicht alle bekommen auch diesen Frieden. Wir wissen und erleben immer wieder, dass unsere Welt trotz der göttlichen Ankündigung von Frieden, alles andere als friedlich ist. Es herrscht Unzufriedenheit trotz Geschenke, Einsamkeit trotz Familienfeiern, Traurigkeit trotz Weihnachtsstimmung. Einige aber leben und leiden in dieser Welt und haben dabei gerade wegen dieser Weihnachtsbotschaft einen Frieden, der nicht durch Krisen, Krebs und Kriege erschüttert werden kann. Die Ursache ihres Friedens liegt über all diesen Dingen. Es ist der Friede, den die Engel den Hirten verkündigten. Ein Friede, der nicht davon abhängt, ob unsere Lebensumstände in Ordnung sind, sondern davon, ob unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Dieser Friede ist in der festen Gewissheit gegründet: Ich habe Frieden mit Gott, der alle Lebensumstände in seiner Hand hält. Weil dieser Gott mich liebt und es gut mit mir meint, kann ich ruhig und hoffnungsvoll sein. So teilt dieser bekannte Weihnachtstext die Menschheit gewissermaßen in zwei Gruppen: Solche, auf die die Herrlichkeit Gottes strahlt und die Frieden mit Ihm haben, weil Gott Wohlgefallen an ihnen hat, und solche, die im Schatten des Weihnachtsfestes stehen und im Unfrieden bleiben. Und beiden Gruppen hat dieser Text etwas zu sagen.
Mehr hier: herold-mission.com.