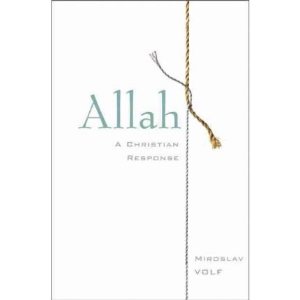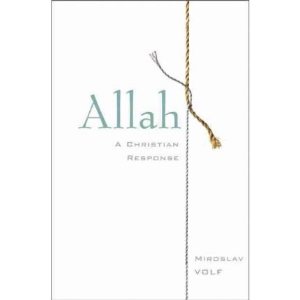 Miroslav Volf (geb. 1956 in Osijek, heute Kroatien) ist einer der wenigen Theologen, die innerhalb und außerhalb der evangelikalen Szene geschätzt werden. Aus einer Pfingstkirche stammend, studierte er zunächst am Fuller Theological Seminary (USA) und promovierte später unter Jürgen Moltmann in Tübingen. Derzeit ist er Henry B. Wright-Professor für Theologie an der Yale University und Direktor des Yale Center for Faith and Culture. Volf ist ausserdem Mitherausgeber der Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosphie (de Gruyter) sowie Gastdozent am Marburger Bildungs- und Studienzentrum (Studiengang Gesellschaftstransformation unter dem Dach des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes).
Miroslav Volf (geb. 1956 in Osijek, heute Kroatien) ist einer der wenigen Theologen, die innerhalb und außerhalb der evangelikalen Szene geschätzt werden. Aus einer Pfingstkirche stammend, studierte er zunächst am Fuller Theological Seminary (USA) und promovierte später unter Jürgen Moltmann in Tübingen. Derzeit ist er Henry B. Wright-Professor für Theologie an der Yale University und Direktor des Yale Center for Faith and Culture. Volf ist ausserdem Mitherausgeber der Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosphie (de Gruyter) sowie Gastdozent am Marburger Bildungs- und Studienzentrum (Studiengang Gesellschaftstransformation unter dem Dach des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes).
Mit seinem Buch Allah hat Volf in der englischsprachigen Welt für ziemlich viel Wirbel gesorgt (Allah: A Christian Response, Verlag HarperOne, 2010). Der evangelikale Theologe geht in seiner Untersuchung der Frage nach, ob Christen und Muslime den gleichen Gott anbeten und kommt zu einem für viele überraschenden Ergebnis: Christen und Muslime glauben an ein und denselben Gott. Dieser Gott fordert die Menschen dazu auf, Gott und den Nächsten zu lieben. Dieses gemeinsame Bekenntnis zur Liebe könne das friedliches Miteinander von Christen und Muslimen begründen und festigen. Der Glaube biete zudem willkommene Ansatzpunkte für die Entwicklung einer interreligiösen Theologie.
Allerdings hat – so der Islamexperte Mark Durie –, die Sachen mehr als einen Haken: Miroslav Volfs „Bild des Islam ist fundamental schief“.
Ich gebe die Buchrezension von Durie deshalb nachfolgend mit freundlicher Genehmigung wieder. Wer den Beitrag mit den entsprechenden Quellen und Fußnoten lesen möchte, kann am Ende des Beitrags eine PDF-Datei herunterladen. Ich danke Dr. Durie für großzügige Erlaubnis, den Text zu übersetzen und R.N. für die eigentliche Übersetzungsarbeit.
Beten wir zum selben Gott?
Eine Rezension des Buches „Allah“ von Miroslav Volf
Mark Durie
„Beten wir zu ein und demselben Gott?“. Dies ist eine heiß diskutierte und kontroverse Frage geworden, die sich in diesen unruhigen Tagen viele Christen im Hinblick auf Muslime und den Islam stellen. Der einflussreiche Theologe Miroslav Volf, der an der Yale Universität den „Henry B. Wright“-Lehrstuhl für systematische Theologie innehat, bietet in seinem neuesten Buch mit dem Titel Allah: A Christian Response eine Antwort auf diese Frage an. Volf genießt beträchtlichen Einfluss und es lohnt sich, dieses Buch ein wenig genauer zu betrachten.
Dreierlei prägende Einflüsse und eine Zielsetzung
Volf nähert sich dieser Frage mit drei prägenden Erfahrungen in seinem biographischen Gepäck, sowie mit einer Zielsetzung bzw. Agenda. Seine erste prägende Erfahrung ist sein langjähriges Engagement bei der Theologie der Versöhnung und Konfliktlösung, im Rahmen derer er sein vielzitiertes Buch Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation verfasst hat. Dieses Anliegen ist ihm aufgrund seiner Kindheit als pfingstkirchlicher kroatischer Christ im kommunistischen Jugoslawien sowie aufgrund einer Reflexion über die Jugoslawischen Kriege in den Jahren 1990–1995 wichtig geworden. Der zweite prägende Einfluss im Leben von Volf bezüglich dieser Thematik ist sein intensiver Dialog mit Muslimen in den vergangenen Jahren, insbesondere anlässlich der „A Common Word“-Initiative. Der dritte Einfluss auf Volf ist sein von ihm verehrter Vater, dem er dieses Buch widmet und welcher Volf von Kind auf seine Sichtweise gelehrt hat: dass nämlich Christen und Muslime denselben Gott anbeten.
Die Agenda oder Zielsetzung, die Volf verfolgt, ist die einer politischen Theologie. Er fragt: „Können religiöse „Exklusivisten“ [also Gläubige, die der Ansicht sind, dass ihre eigene Religion die wahre ist, die andere Religion jedoch nicht, Anm. d. Übers], wenn sie Anhänger verschiedener Religionen sind (d.h. die meisten Muslime und Christen), komfortabel zusammenleben unter dem gleichen politischen Dach und gut miteinander auskommen?“ (S. 220). Volfs Antwort auf diese Frage ist ein klares „Ja“ auf der Basis des gemeinsamen Glaubens an den einen Gott.
Der Ansatz der „Konzentration auf die Gemeinsamkeiten“
Um Volfs Ansatz und seine Schwächen gebührend würdigen zu können, müssen wir uns sein Prinzip der „Konzentration auf die Gemeinsamkeiten“ ansehen. Seine Regeln für die Diskussion mit dem jeweils Andersdenkenden sind: 1. „Konzentriere Dich auf das, was beiden gemeinsam ist“, und 2. „Halte gleichzeitig ein Auge dafür offen, wesentliche Unterschiede feststellen zu können“.
Herzstück des Buches Allah sind einige Aussagen über Gott, von denen Volf meint, dass der „normative Islam“ und das „normative Christentum“ darin übereinstimmen (S. 123). Von diesen gemeinsamen Überzeugungen ausgehend entwirft er eine politische Lösung dafür, wie die beiden Religionen im Frieden zusammenleben können.
Laut Volf sind die sechs Kernaussagen des Monotheismus die Folgenden: (1) Es gibt nur einen Gott. (2) Gott hat alles geschaffen, was nicht Gott ist. (3) Gott ist radikal anders als alles, was nicht Gott ist. (4) Gott ist gut. (5) Gott gebietet uns, Gott zu lieben. Und (6) Gott gebietet uns, den Nächsten zu lieben wie uns selbst.
Die ersten vier dieser Kernaussagen, so Volf, begründen seine These, dass Menschen, wenn sie „Gott“ (oder „Allah“) sagen, sich auf das gleiche Objekt beziehen, während die letzten beiden der Kernaussagen diese These bekräftigen (S. 110). Volf unterscheidet zwischen „sich nur auf Gott zu beziehen“ oder „Gott wirklich anzubeten“, und stellt folgende These auf: „In dem Maße, wie Christen und Muslime danach streben, Gott und den Nächsten zu lieben, beten sie denselben wahren Gott an“ (S. 124). Der Allah, von dem der Koran spricht, so Volf, ist der Gott der Bibel, und dieser eine Gott „verlangt von Muslimen und von Christen die Einhaltung von erstaunlich ähnlichen Geboten als Ausdruck ihrer Anbetung“ (S. 124).
Volf setzt sich für die Freiheit der Religionsausübung ein und sagt, dass der gemeinsame Glaube an den einen Gott sowohl von Muslimen als auch von Christen fordert, die Neutralität des Staates gegenüber allen Religionen zu unterstützen (S. 238) und speziell die Freiheit der Religionsausübung zu befürworten, bei der sich der Staat nicht einmischt. Diese Freiheit solle auch die Freiheit einschließen, seine Religion zu verlassen oder zu ändern (S. 234). Diese Schlussfolgerung ruht entscheidend auf der These von Volf, dass Muslime und Christen beide gleichermaßen Gottes Gebot der Nächstenliebe für sich als verbindlich ansehen.
Vollgepackt mit interessanten Ansichten
Volf nennt sein Buch Allah ein „heiß serviertes und stark gewürztes Gericht“; das Buch ist voll von interessanten Ideen und Einsichten. Volfs Gedanken über das, was Nicolaus Cusanus und Martin Luther über den Islam zu sagen hatten (Kapitel 2–3), sind sehr reichhaltig; genauso seine Diskussion der Dreieinigkeit in Kapitel 7, in der er behauptet, dass das, was Muslime an der Dreieinigkeit ablehnen, auch von den orthodoxen Christen abgelehnt wird, und dass „Christen das bekräftigen, was Muslime über die Einheit bzw. das Einssein Gottes bekräftigen“ (S. 143).
Ein weiterer interessanter Aspekt des Buches Allah liegt in Volfs Fähigkeit, aufzuzeigen, dass das Christentum in der Geschichte genau die gleichen Vergehen auf seinem Konto stehen hat, wie es einige Christen heute dem Gott des Islam zuschreiben, so wie z.B. die Verfolgung von Apostaten [d. h. Menschen, die sich vom Glauben abgewendet haben, Anm. d. Übers.], oder den Einsatz von Waffengewalt oder Krieg, um Menschen zum richtigen Glauben zu bringen bzw. darin zu erhalten.
Blinde Flecken: Krieg gegen Ungläubige
Volfs Aussagen über den Islam verraten jedoch große blinde Flecken, die zum Teil daraus resultieren, dass er sich zu unkritisch auf die Aussagen seiner Dialogpartner verlässt. Dieses Problem ist besonders gravierend in seiner Behandlung des Themas „Krieg gegen Ungläubige“, welches doch ein wesentlicher Aspekt für die Frage nach der Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens ist.
Selbstmordattentate
Beispielsweise zitiert Volf in einer kurzen Diskussion von Selbstmordattentätern den Brief an Papst Benedikt als Beweis dafür, dass der „normative Islam“ das verdammt, was er „Selbstmord-Terrorismus“ nennt (S. 112). Jedoch befinden sich in dem Amman-Brief keinerlei Bezüge dazu und keine Diskussion von Selbstmordattentaten.
Eine der Aussagen von Volf ist, dass der Islam Selbstmord ablehne. Jedoch scheint ihm nicht bewusst zu sein, dass sich unter den Unterzeichnern des Amman-Briefes mehrere Gelehrte befinden, die sogenannte „Einsätze von Märtyrern“ (d. h. Selbstmordattentate) gebilligt haben. Diese Gelehrten sehen solche Einsätze allerdings nicht als Selbstmord an:
- Scheich Ali Jumu´ah, Großmufti von Ägypten und Unterzeichner des Amman-Briefes, hat gesagt: „Derjenige, der Fedaii-Einsätze (Märtyrer-Einsätze) gegen Zionisten ausführt und sich selbst in die Luft jagt, ist ohne Frage ein Shahid (Märtyrer), weil er sein Heimatland gegen einen Besatzerfeind verteidigt, der von Supermächten wie den USA oder Großbritannien unterstützt wird.“
- Der zweite Unterzeichner des Amman-Briefes, Professor al-Buti, hat gesagt, dass Märtyrer-Einsätze vollständig legitim sind, wenn ihr Motiv ist, dem Feind Verdruss zu bereiten bzw. zu schaden.
- Ein weiterer Unterzeichner, Scheich Ahmad al-Khalili, Großmufti von Oman, hat gesagt: „Wir sind ziemlich sicher, dass Juden bald vom Erdball vertilgt sein werden, dies ist die Verheißung Allahs … Selbstmord ist menschliche Langeweile und der Wunsch, sich deshalb selbst zu töten. Aber die palästinischen Mudschaheddin empfinden keine Langeweile über ihr Leben, und ihre Zielsetzung war nicht, sich selbst umzubringen: stattdessen wollten sie ihren Feinden Verdruss bereiten.“
In Wahrheit heißen viele führende muslimische Gelehrte die sogenannten „Märtyrereinsätze“ gut, während sie die Sichtweise verwerfen, dass diese Handlungen “Selbstmord” seien. Wenn es die Absicht des Attentäters sei, einen legitimen Feind anzugreifen, dann handle es sich bei einem solchen Anschlag, bei dem man sich selbst mit in die Luft jagt, gar nicht um Selbstmord.
Offensiver Jihad
Ein noch schwerwiegenderer blinder Fleck zeigt sich, wenn Volf behauptet, dass die Verwendung von militärischer Macht zur Verbreitung des Islam „von allen führenden islamischen Gelehrten heute abgelehnt wird“ (S. 210): Wieder verweist er auf den Amman-Brief.
Jedoch steht in dem ganzen Amman-Brief keine Silbe, mit der „offensiver Jihad“ (bzw. „aggressiver Jihad“) abgelehnt wird. Was der Brief ablehnt, ist, Leute nur wegen ihres Glaubens umzubringen sowie die Anwendung von Gewalt, um eine Bekehrung zu erzwingen. Der Brief wendet sich aber nicht gegen den Gebrauch von Waffengewalt, um die politische Dominanz des Islam über Ungläubige auszudehnen.
Wie Haykals großangelegte Analyse über den Jihad im Islam aus dem Jahre 1993 zeigt, befürworteten viele führende islamische Gelehrte sowohl in der Vergangenheit als auch heute den Jihad als Mittel, um dem Islam zur weltweiten Dominanz zu verhelfen. Dass es das Ziel des militärischen Jihad ist, den Islam auszubreiten, wird von der Konsens-Sicht der klassischen Gelehrten gestützt, inklusive des Gelehrten al-Ghazali von der Schafiitischen Rechtsschule des Islam, von dem Volf schreibt, „er ist auf vielerlei Weise der repräsentativste muslimische Denker, den man in allen Jahrhunderten finden kann“ (S. 169). Aggressiver bzw. offensiver Jihad wird auch von vielen saudi-arabischen Gelehrten befürwortet, wie etwa von Scheich Muhammad al-Munajid, der gesagt hat: „Zweifellos sind offensive kriegerische Handlungen sehr effizient, um den Islam auszubreiten und Leute in Massen der islamischen Religion zuzuführen.
Selbst unter den Unterzeichnern des Amman-Briefes und des „Common Word“-Briefes befinden sich Befürworter des offensiven Jihads. Zum Beispiel hat M. Taqi Uthmani, einer der heute weltweit führenden islamischen Rechtsgelehrten und Unterzeichner beider Briefe, gelehrt, dass „offensiver Jihad auch heute rechtmäßig ist … Seine Rechtfertigung kann nicht verschleiert werden … wir sollten diesen Expansionismus mit absolutem Selbstbewusstsein befürworten“.
Muhammad Salim al-Awwa, ein bedeutender ägyptischer Geistlicher, ist ein weiterer bekannter Gelehrter, der die „Common Word“-Initiative unterzeichnet hat. Er hat darauf hingewiesen, dass das Wort für islamische Eroberungen auf Arabisch futūh („Öffnungen“) ist. Al-Awwa erklärt, dass es im Islam Zweck der Eroberungen ist, „den Weg für Muslime zu ebnen und freie Bahn zu schaffen für die Einladung zum Glauben an Allah ohne die Behinderung durch [nichtmuslimische] Herrscher.“ Mit anderen Worten: Eroberung öffnet ein Land dem Islam, indem die politischen Hindernisse für die islamische Mission aus dem Weg geräumt werden.
Das Töten “Unschuldiger”
An manchen Stellen erscheint Volf geradezu gutgläubig. Er zitiert den oft wiederholten Anspruch, dass der Islam „das Töten Unschuldiger“ verbiete, während die Rechtssprechung der Scharia in Wirklichkeit nur das Töten derer verbietet, die laut islamischem Recht nicht getötet werden dürfen. Die klassische Sichtweise ist, dass das Blutvergießen von Ungläubigen, die nicht unter einem Dhimmi-Pakt leben, halal ist (d. h. es ist erlaubt, sie zu töten).
Während es wahr ist, dass die Gesetze des Jihad das Töten von Frauen und Kindern verbieten – diese sollten nicht getötet, sondern versklavt werden –, ist es hingegen erlaubt, einen ungläubigen erwachsenen Mann umzubringen, sei er nun „unschuldig“ oder nicht. Selbst das Töten von Frauen und Kindern als „Kollateralschaden“ ist erlaubt. Zum Beispiel schrieb die von Volf geschätzte Autorität al-Ghazali: „Man muss mindestens einmal pro Jahr in den Jihad ziehen … man darf ein Katapult gegen sie benutzen, wenn sie sich in einer Festung befinden, selbst wenn auch Frauen und Kinder unter ihnen sind. Man darf sie in Brand setzen und/oder sie ertränken.“
Kein Wohlwollen für abweichende Sichtweisen
Auf der einen Seite ist Volf zu großzügig, wenn er seine Dialogpartner interpretiert, denn er entdeckt bei ihnen eine Ablehnung der unerwünschten Aspekte der Scharia, während die Gesprächspartner diese Aspekte in Wirklichkeit gar nicht ablehnen. Auf der anderen Seite stellt er eine Sichtweise, die seiner Sicht entgegengestellt ist, falsch dar. In meinem Buch Revelation (dt. Offenbarung) habe ich geschrieben, dass man bei einem Vergleich des Gottes des Koran und der Bibel die Unterschiede betrachten muss, nicht nur die Ähnlichkeiten. Volf geht auf diesen Teil meines Buches Revelation ein, aber er entstellt den Sinn, indem er sagt:
„Durie … behauptet, wenn keine vollständige Übereinstimmung in der Beschreibung des Gottes im Islam und im Christentum vorliegt, dann sind sie nicht identisch. Um herauszufinden, ob der Gott des Korans ein echter oder falscher Gott ist, sollte die Vorgehensweise dieselbe sein wie wenn man versucht herauszufinden, ob eine Banknote echt oder gefälscht ist. Wenn es irgendwelche Unterschiede zu der Banknote gibt, von der du weißt, dass sie echt ist, dann ist die andere gefälscht.“ (S. 91–92, Hervorhebungen von Volf).
Volf baut hier künstlich eine Vogelscheuche auf, die er dann widerlegt. In Wirklichkeit habe ich nirgends behauptet, dass eine vollständige Übereinstimmung vorliegen muss, damit Identität vorliegt. Noch muss das Auffinden von irgendwelchen Unterschieden schon zu der Schlussfolgerung führen muss, dass der Gott der Bibel und des Korans nicht dieselben sind. Ich habe vielmehr ausgeführt, dass Unterschiede zwar wichtig sind, aber dass das bloße Aufzählen von Unterschieden noch nicht hinreichend ist, um die Einheit zu widerlegen. Stattdessen muss man sich auf die tieferen und grundlegenden Eigenschaften Gottes konzentrieren und ich habe diesen tieferliegenden Unterschieden mehrere Kapitel gewidmet.
Ein entscheidender blinder Fleck: Welchen Nächsten soll man lieben?
Der Knackpunkt ist das, was Volf über die Liebe Gottes sagt. Absolut ausschlaggebend für die Argumentation von Volf ist eine Hadith (eine Überlieferung über das Leben Mohammeds), in dem ein Gebot steht, „alle“ Nächsten zu lieben (S. 182), inklusive aller Nichtmuslime. Volf scheint diese Einsicht aus dem „Common Word“-Brief zu entnehmen, welche eine überarbeitete Version dieser Hadith zitiert.
Weil dies ein so zentraler Punkt im Buch Allah ist, gebe ich hier den genauen Wortlaut dieser Hadith wieder [die englische Übersetzung ist die von Abdul Hamid Siddiqui; hier übersetzt aus d. Engl., Anm. d. Übers.], inklusive der Kapitelüberschrift:
Kapitel 18: BETREFFEND DIE TATSACHE, DASS ES EIN CHARAKTERISTIKUM DES IMAN (GLAUBENS) IST, DASS MAN FÜR DEN BRUDER IM ISLAMISCHEN GLAUBEN DASSELBE WÜNSCHEN SOLL WIE MAN ES FÜR SICH SELBST WÜNSCHT
§72: Es ist festgelegt bei der Autorität des Anas B. Malik, dass der Prophet (Gott segne ihn und schenke ihm Heil) bemerkt hat: jemand unter euch glaubt (wahrhaftig), wenn er für seinen Bruder oder für seinen Nächsten das wünscht, was er für sich selbst wünscht.
§73: Es wird erzählt bei der Autorität des Anas, dass der Prophet (Gott segne ihn und schenke ihm Heil) bemerkt hat: Bei Ihm, in dessen Hand mein Leben ist, kein Bundesgenosse glaubt (wahrhaftig), bis er für seinen Nächsten wünscht, oder er (der Heilige Prophet) sagte: für seinen Bruder wünscht, was auch immer er für sich selber wünscht.
Das erste, was einem bei dieser Hadith auffällt, ist, dass die Kapitelüberschrift in eben der Quelle, die Volf zitiert, deutlich macht, dass diese Überlieferung davon handelt, dass man seinen muslimischen Nächsten lieben soll. Das zweite, was man feststellt, ist, dass die bevorzugte Lesart (also die zuerst genannte) Bruder ist, was sich im Islam auf andere Muslime bezieht. Auch eine Variante dieser Tradition, die als noch zuverlässiger angesehenen wird, eine Überlieferung nach Sahih al-Bukhari, lautet: „Der Prophet sagt, „Keiner von euch wird Glauben haben, bis er für seinen [muslimischen] Bruder das gleiche wünscht, was er für sich selbst wünscht“.
Es ist auch auffällig, dass Volf keinen einzigen Vers aus dem Koran zitieren kann, der die These stützt, dass Gott gebietet, dass man seinen Nächsten lieben soll. Was man aber stattdessen im Koran finden kann, sind beunruhigende Instruktionen, wie man sich gegenüber seinem nichtmuslimischen Nächsten verhalten soll, wie etwa in Sure 9,123: „Ihr Gläubigen! Kämpft gegen diejenigen von den Ungläubigen, die euch nahe sind (d. h. die mit ihren Wohnsitzen an euer Gebiet angrenzen)! Sie sollen merken, dass ihr hart sein könnt. Ihr müsst wissen, dass Gott mit denen ist, die (ihn) fürchten.“
Gott lieben?
Zweifelhaft ist auch der Satz, den Volf gebraucht, um seine Sichtweise zu belegen, dass der Islam „gebietet, Gott mit dem ganzen Sein zu lieben“ (S. 104). Er zitiert Allahu wahdahu, „Gott allein“, übersetzt dies aber ziemlich großzügig als „Gott, den einen und einzigen“. Allerdings steht in Sure 39,45 wörtlich: „Wenn Gott allein erwähnt wird, krampft sich denen, die nicht an das Jenseits glauben, das Herz zusammen. Wenn aber diejenigen (Götter) erwähnt werden, die es (angeblich) außer ihm gibt, sind sie gleich froh (und glücklich).“ Es ist schwierig, dies als ein Gebot zu lesen, „Gott mit seinem ganzen Sein zu lieben“, denn die Absicht des Verses ist einfach, diejenigen im Kontext des zukünftigen Gerichtes Gottes zu verdammen, die eine Vielzahl von Göttern anbeten.
Es geht um mehr als um Liebe
Es ist enttäuschend, dass Volf sich in seiner Betrachtung von Gottes Charakter nur auf den einen Aspekt beschränkt, nämlich „Gott ist Liebe“. Sicherlich müsste für einen Christen vor allem bei diesem Punkt eine Übereinstimmung herrschen, bevor man der These zustimmen könnte, dass „wir denselben Gott anbeten“. Jedoch gibt es noch andere herausragende Eigenschaften Gottes in der Bibel und es wäre fruchtbar gewesen, diese im Zusammenhang eines Dialogs mit dem Islam zu behandeln, wie etwa Gottes Heiligkeit, seine Bundestreue, seine göttliche Gegenwart und seine Schöpfung des Menschen in seinem Ebenbild.
Logische Sprünge und selektive Verwendung von Fakten
Der Eindruck, den man beim Lesen während des gesamten Buches Allah gewinnt, ist, dass der Autor darauf erpicht ist, sein erwähntes Ziel zu erreichen, nämlich eine politische Theologie für ein friedliches Zusammenleben zu formulieren. So sehr ist dem Autor daran gelegen, dass er blind für Fakten ist, die gegen seine Sichtweise sprechen, selbst wenn diese Fakten leicht zugänglich sind. Er macht unbegründete logische und rhetorische Sprünge, um sein Ziel zu erreichen.
Beispielsweise zitiert Volf Verse, die zeigen sollen, dass der Gott des Korans ein liebender Gott ist (S. 101), aber dann transformiert er dies ohne weitere Erklärung unmittelbar in „Gott ist gut“. Diese beiden Thesen sind nicht dasselbe, und die erste ist aus dem Koran viel einfacher zu begründen als die zweite: „Der Gute“ ist keiner der berühmten 99 Namen Allas, die sich im Koran finden.
Ein weiteres Beispiel ist die Aussage von Volf, dass die Gebote im Koran den Zehn Geboten des Mose ähneln. Problematisch ist, dass es andere Gebote im Koran gibt, die den Zehn Geboten widersprechen, besonders im Kontext der Beziehungen zu Nichtmuslimen. Zum Beispiel gibt es Verse, die gebieten, Ungläubige zu töten (z. B. Sure 9,5); einen Vers, der sexuellen Verkehr mit (nichtmuslimischen) verheirateten gefangenen Frauen erlaubt (Sure 4,24; vgl. a. 4,3; 23,6; 33,50; 70,29–30); Verse, die Muslime ermutigen, Beute von Ungläubigen zu nehmen (z. B. Sure 48,20); einen Vers und eine zugeordnete Hadith, die Muslime ermutigt, ihre nichtmuslimischen Eltern nicht zu ehren, wenn sie dem Islam feindlich gegenüberstehen (Sure 60,6–8); und Verse, die dazu anleiten, Ungläubige unter bestimmten Umständen zu täuschen (z. B. Sure 3,28).
Beweis durch Widerlegung?
Volfs Methode setzt sich weder objektiv noch in einer gründlichen und strengen Analyse mit dem Islam auseinander, in der er sorgfältig die Argumente und Aussagekraft für und gegen seine einzelnen Positionen abwägt. Stattdessen konzentriert er sich auf Gemeinsamkeiten, um seine sechs Prinzipien zu belegen und begründet jede dieser Prinzipien mit einem oder zwei isolierten Versen und konstruiert dann sein Argument auf diesem Fundament, wie es scheint in glanzvoller Abkoppelung und Isolation von islamischer Theologie und Rechtsprechung.
Das Gewicht der Beweise ist erdrückend. Es reicht nicht, nur darauf hinzuweisen, dass etwas irgendwo im Koran gefunden werden kann. Man muss auch fragen, wie zentral dieses Thema im ganzen Buch ist. Zum Beispiel findet sich die Aussage, dass Gott liebt, nur zweimal im ganzen Koran (Sure 11,90; Sure 85,14). Eine große Zahl anderer Eigenschaften Gottes sind weit zentraler und werden viel öfter erwähnt (wie etwa „der Schöpfer“ oder „der Allmächtige“). Der Mangel an Erwähnungen der Liebe Gottes im Koran steht im Kontrast zu den hunderten Erwähnungen von Gottes Liebe in der Bibel, inklusive der zentralen Beschreibungen des Charakters Gottes, wie etwa Gottes Offenbarung seiner selbst zu Moses in Exodus 34,6. Ein Beispiel dafür, wie abgekoppelt und isoliert die Gedanken Volfs vom islamischen Denken sind, ist das Folgende: Zwar entwickelt Volf den Gedankengang, dass der Monotheismus des „normativen Islams“ den politischen Inklusivismus fördern sollte, anstatt Exklusivismus zu stärken (S. 246). Jedoch widmet Volf der Frage keinerlei Raum, auf welcher Basis der Islam seine Ungleichbehandlung der „Dhimmis“, also von Nichtmuslimen, in einer islamischen Gesellschaft, rechtfertigt.
Das Ergebnis ist, dass die Schlussfolgerungen Volfs den normativen islamischen Glaubensinhalten und der Lebenswirklichkeit widersprechen. Diese Lücke ist bei Themen wie Religionsfreiheit, Behandlung von Apostaten [d. h. Menschen, die sich vom Glauben abkehren, Anm. d. Übers.] und dem politischen Status von Nichtmuslimen in einem islamischen Staat so groß, dass er geradezu eine Widerlegung seiner eigenen Position betreibt, da seine Grundannahmen durch seine Schlussfolgerungen unterminiert werden.
Wie steht’s mit Mohammed?
Vielleicht der größte blinde Fleck im Buch Allah ist die Person Mohammeds. Der Islam gründet sich nicht nur auf den Koran, sondern auch auf Mohammed. Die Scharia als System für das ganze Leben ist mit äußerster Sorgfalt auf den Einzelheiten des Lebens Mohammeds aufgebaut, den der Koran wiederholt als das „beste Vorbild“, dem man folgen sollte, lobt. Das Problem dabei ist, dass Mohammeds Verhalten viele Fälle von schlechter Behandlung und Unterjochung von Nichtmuslimen einschließt, im Gegensatz zu vielen Ermutigungen für Muslime, ihre Mitmuslime mit Respekt zu behandeln.
Wenn Mohammed seine nichtmuslimischen Nächsten nicht wie sich selbst geliebt hat und wenn er das beste Vorbild für Muslime ist, dem sie folgen sollen, wie kann der Islam die moralische Kraft dieses Vorbilds übersehen? Die Annahme von Volf, dass der Islam seine politische Vision auf einige wenige Prinzipien über den Charakter Gottes zurückführt, – von denen einige selten oder nie im Koran erwähnt werden –, ignoriert die Realität auf naive Weise. Weil Volf gegenüber Mohammed wissentlich ein Auge zudrückt, unterschätzt er auch vollständig die Rolle der Scharia als das dringlichste Thema für die Frage des Zusammenlebens von Muslimen und Nichtmuslimen.
Dies scheint auch der Grund dafür zu sein, dass Volf kein Wort über den wachsenden Druck seitens muslimischer Gruppen verliert, die bestrebt sind, in westlichen Nationen ein paralleles Rechtssystem aufzurichten. In allen Immigrationsländern erbitten oder fordern muslimische Gemeinschaften, dass nichtmuslimische Regierungen unterschiedliche rechtliche Zuständigkeitsbereiche anerkennen, damit auch die Scharia Geltung erhält. Überall entstehen heutzutage Scharia-Gerichte, von London bis Sydney; dies ist eine der größten praktischen Herausforderungen für Volfs Vision eines gemeinsamen politischen Daches für Muslime und Christen. Wenn sich Volf jedoch überhaupt nicht mit dem Thema Mohammed und seiner Scharia auseinandersetzt, hat er nichts Relevantes über die wirkliche Welt der religiösen Koexistenz zu sagen.
Es muss auch betont werden, dass die Einführung kein spezifisch muslimisch-christliches Thema ist. Die Scharia stellt vielmehr ein umfassendes Problem für die Menschenrechte weltweit dar und betrifft sowohl Hindus in Pakistan, Zoroastrier im Iran, Ahmadiyas in Indonesien oder Apostaten vom Islam in fast jeder Nation. Es betrifft natürlich auch muslimische Frauen in aller Welt. Die Frage ist nicht, wie Christen und Muslime zusammenleben können, sondern wie der Islam mit dem Nichtislam zusammenleben kann. In weiser Voraussicht hat William Montgomery Watt 1993 folgende Worte ausgesprochen: „Zweifellos gibt es einige islamische Staaten, die nichtmuslimische Bürger so behandeln, dass man das nur als Unterdrückung bezeichnen kann … Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass muslimische Juristen überlegen sollten, ob solch eine Behandlung mit der Scharia im Einklang steht oder nicht. Allgemeiner gesagt: Erlaubt die Scharia Muslimen, friedlich mit Nichtmuslimen in der ‚einen Welt‘ zusammenzuwohnen? … Eine Antwort auf diese Fragen könnte in wenigen Jahren sehr dringlich werden.“
In Wirklichkeit lehren sowohl Mohammed, der Koran als auch der „normative Islam“ in konsistenter Weise – und darüber kann man sich keineswegs freuen –, dass Muslime danach streben sollten, politische Vorherrschaft über die Anhänger anderer Religionen zu erzielen. Zum Beispiel heißt es in Sure 48,28: „Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der wahren Religion geschickt hat, um ihr [d. h. der wahren Religion (des Islam)] zum Sieg zu verhelfen über alles, was es [sonst] an Religion gibt“. Diese Überzeugung wird in unzähligen Kommentaren, rechtlichen Lehrbüchern und Schriften muslimischer Gelehrter der Vergangenheit und Gegenwart dargelegt. Diese Sicht ist Teil des „normativen Islams“, von dem sich der islamische Mainstream nicht losgesagt hat. Es ist dieser Felsen, an dem Volfs gesamte Abhandlung zerschellt.
Unvoreingenommenheit oder „Du tust ja dasselbe“-Vorwürfe?
Ein frustrierender Aspekt des Buches Allah ist Volfs subtiler Rückgriff auf eine „tu quoque“-Argumentationsweise [lat. für „du auch“; dabei spiegelt man einen Vorwurf zurück an den Beschuldiger und wirft ihm vor, dass dieser ja dasselbe tue; Anm. d. Übers.]. Damit lenkt er von zentralen Themen ab. Zum Beispiel erwähnt Volf das Konzept des „Dhimmi-tums“ – welches so wesentlich für das muslimisch-christliche Zusammenleben ist – nur im Kontext einer Diskussion von christlich motiviertem religiösem Zwang aus dem 16. Jahrhundert (S. 225). Seine scheinbar unvoreingenommene Darstellung unterstreicht Volfs Betonung, dass Intoleranz ein universales menschliches Problem ist. Jedoch verschleiert Volf damit seine Weigerung, sich mit der theologischen Basis, also der aus dem Koran theologisch begründeten Ungleichbehandlung im Islam auseinanderzusetzen. Daher behandelt Volf auch nirgends Sure 9,29, welche vielleicht der zentrale Vers ist, um den Status von Christen in islamischer politischer Theologie zu bestimmen.
Vorsicht vor dem Klappentext
Der Leser sollte sich auch vorsehen, den Text des Einbands nicht Volf zuzuschreiben. Auf dem Einband, der vom Verlag gestaltet wurde, heißt es: „Eine Person kann sowohl praktizierender Muslim als auch 100-prozentiger Christ sein, ohne seine Kernüberzeugungen oder Glaubenspraxis zu verleugnen“. Dies ist eine unglückliche Missdeutung, denn Volf sagt eigentlich nur, dass eine Person 100-prozentig Christ sein kann, während er bestimmte muslimische Praktiken ausübt, wie etwa Fasten während des Ramadans, oder Mohammed in einem nicht-religiösen Sinne des Wortes einen „Propheten“ zu nennen. Es wäre hilfreicher, wenn Volf dargelegt hätte, warum der Glaube an Mohammed als einen Propheten im orthodoxen islamischen Sinne nicht vereinbar ist mit dem christlichen Glauben. Im gesamten Buch sollte der Leser vorsichtig sein, nicht Folgerungen in Volfs Text hineinzulesen, die nicht explizit im Text stehen; denn in seinem Bemühen, die Gemeinsamkeiten zu maximieren, segelt Volf manchmal sehr nah am Wind und schreibt nicht deutlich, welche Grenzen er nicht überschreiten würde.
Für wen ist „Allah“ eigentlich geschrieben?
Es besteht eine Spannung bezüglich der Frage, wer die beabsichtigte Leserschaft des Buches Allah sein soll. Auf der einen Seite behauptet Volf wiederholt, das er das Buch für Christen geschrieben hat. Aber es sind doch vor allem Muslime, die man von dem von ihm vorgeschlagenen „Dach“ für ein friedliches Zusammenleben überzeugen muss.
Während Volf ausführlich argumentiert, dass der normative islamische und christliche Monotheismus die Prinzipien der Religionsfreiheit unterstützen sollte, muss man doch die meisten heutigen Christen nicht mehr von diesen Prinzipien überzeugen, was ihr eigenes Gottesverständnis angeht. Auf der anderen Seite: Wenn Volfs Behauptungen über den islamischen Gott Muslime nicht überzeugen können, was nutzt es dann, wenn Christen über den Gott des Koran nachdenken?
Volf hat eine Feier angekündigt, die unter einem gemeinsamen politischen Dach stattfinden soll, zu Ehren der Liebe zu Gott und zum Nächsten. In gewisser Weise sind die Christen schon auf dem Fest: für sie ist das Dach schon vorhanden. Die Muslime sind im Großen und Ganzen noch nicht dort angekommen. Mit Allah hat Volf ein Buch geschrieben, mit dem er Christen überzeugen will, dass Muslime auf der Party erscheinen sollten, aber am Ende wird dies wenig Unterschied machen dafür, ob die Feier wirklich stattfinden wird. Das Entscheidende ist doch, ob die Muslime teilnehmen werden, und nicht, dass man die Christen überzeugt, dass die Muslime teilnehmen sollten.
Wenn Volf sich über den Islam täuscht – und ich glaube, das ist der Fall –, und wenn die gesamte christliche Welt so denken würde wie er, wäre die Folge, dass Christen nichts tun würden, um der aufsteigenden islamischen Ideologie, die nach der Vorherrschaft strebt, etwas entgegenzusetzen, weil sie die ganze Zeit überzeugt sind, dass der „normative Islam“ die Prinzipien wie Gleichheit und Freiheit unterstützt. Dies könnte ein Rezept für einen langanhaltenden spirituellen Niedergang sein, der schlussendlich in einer politischen Kapitulation mündet.
Nur für westliche christliche Augen?
Das Buch Allah zielt stark auf eine westliche christliche Leserschaft ab. Für Christen, die heutzutage unter islamischer Vorherrschaft leben, selbst in Ländern, in denen einige der Dialogpartner von Volf führende Positionen innehaben, könnte dieses Buch jedoch großen Schmerz und Anstoß erregen, denn es leistet keinerlei Beitrag zu einem konsistenten Verständnis der Ursachen der Bedrängnis von Nichtmuslimen, die in islamischer Theologie und Rechtsprechung begründet liegen.
Liebe sticht die Wahrheit aus
Volfs Allah ist ein gutgemeinter Versuch, eine interreligiöse Theologie für politische Koexistenz und Frieden unter „demselben politischen Dach“ zu formulieren (S. 220). Obwohl sein Gedankengebäude auf einer tiefen Kenntnis des Christentums mit all seinen Schwächen basiert, ruht es doch auf blinden Flecken und Wunschdenken gegenüber dem Islam. Volf hat eine himmlische Freude daran, sich auf das zu konzentrieren, was gut und ähnlich beim anderen ist. Dies ist für sich genommen zwar lobenswert, aber seine Methode lässt ihn im Stich, weil er wiederholt die Gemeinsamkeiten überbetont und das übersieht, was unterschiedlich ist. Sein liebevoller Blick auf den Islam ist heuristisch gesehen ein Fehlschlag. Volf sieht Allah mit christlichen Augen an, er sieht den Gott der Bibel in den Seiten des Korans, ist jedoch oft blind für gegensätzliche Indizien. Sein Bild des Islam ist fundamental schief. Dies ist eine Form des Vorurteils, nicht geboren aus einer feindlichen Angst vor dem anderen, sondern vielmehr geboren aus der Angst, den anderen bloß nicht auszuschließen. Dies ist eine Angst, nicht christlich genug zu sein. Leider führt das dazu, dass mit Volfs Methode – zugegebenerweise entgegen seiner Absicht (S. 259) – die Liebe die Wahrheit übertrumpft. Caveat lector.
– – –
Dr. Mark Durie ist Anglikanischer Vikar und Menschenrechtsaktivist. Er ist der Autor dreier Bücher über den Islam, inklusive The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom, Verlag Deror Books 2010. Diese Rezension wurde zuerst veröffentlicht in der Juli-August Ausgabe der Zeitschrift Quadrant (www.quadrant.org.au). Die deutsche Übersetzung und Veröffentlichung erfolgte mit freundlicher Genehmigung des Autors. Übersetzt wurde der Text von R.N.
Hier die PDF-Datei mit den Fußnoten: Volf.pdf