Markus Till hat auf seinem Blog den Artikel „The Failure of Evangelical Elites“ (erschienen bei First Things) von Carl Trueman zusammengefasst. Trueman fragt unter anderem, warum es trotz der Arbeiten von Mark Noll und George Marsden den Evangelikalen nicht gelungen ist, in der akademischen Welt Fuß zu fassen (siehe zu Noll und Marsden auch das Interview hier). Nach Trueman liegt es nicht an mangelhaften akademischen Fähigkeiten oder an den schlechten Argumenten. Vielmehr macht er die „Woke-Kultur“ an den Hochschulen für diese Entwicklung verantwortlich. „Woke“ bezeichnet eine Haltung, die „aufgeweckt“ nach fehlender sozialer Gerechtigkeit, Rassismus oder Ungleichbehandlung Ausschau hält und diese Dinge aktionistisch anprangert. Die „Woke-Kultur“ trägt mit dazu bei, dass nur noch bestimmte Meinungen als diskursfähig gelten. Theorien oder Überzeugungen, die dem „Mainstream“ nicht entsprechen, sollen am Besten gar nicht mehr zu Wort kommen (hier liegen die Schnittstellen zur Abbruchs-Kultur (engl. Cancel Culture). Die christlichen Wissenschaftlicher werden nach Trueman also gemieden, weil man ihren Glauben und ihre Ethik für ethisch verwerflich hält.
Markus Till schreibt:
Die Thesen von Noll und Marsden schienen anfangs gute Früchte zu tragen. Ihre Doktoranden erhielten Stellen an Hochschulen und Universitäten. Als Musterbeispiel diente viele Jahre der von Obama eingesetzte evangelikal geprägte Leiter des Nationalen Gesundheitsinstituts Francis Collins. Gerade an seinem Beispiel macht Trueman jedoch deutlich, wie schwer es offenkundig ist, als evangelikaler Christ in solche Positionen aufzusteigen, ohne seine christlichen Werte zu kompromittieren. Collins ist dies offenbar nicht gelungen. Und Trueman stellt fest, dass es heutzutage kaum noch möglich ist, konfliktfrei an wichtigen christlichen Überzeugungen innerhalb der intellektuellen Eliten festzuhalten:
„Obwohl Marsden und Noll ihre Argumente vor weniger als dreißig Jahren vorbrachten, fällt mir auf, dass ihre Argumente aus einer längst vergangenen Zeit stammen. Die Vorstellung, dass eine Person, die sich zu Ehrlichkeit und Integrität in der Wissenschaft bekennt, Mitglied der heutigen Universitäten und anderer führender Institutionen werden kann, ist rückblickend betrachtet naiv. … Letztes Jahr habe ich am Grove City College einen Kurs über historische Methoden gehalten. Einer unserer Texte war Marsdens ‘The Outrageous Idea of Christian Scholarship’. Die Reaktion der Studenten auf das Buch war beeindruckend. Obwohl sie Marsden für einen nachdenklichen und engagierten Autor hielten, waren sie der Meinung, dass sein Argument – dass Christen einen Platz am Tisch der akademischen Welt finden könnten, wenn sie gute Gelehrte seien und ihre Kollegen mit Respekt behandelten – im heutigen Kontext nicht überzeugend ist. Kein Student glaubt heute, dass ein Professor einer Forschungsuniversität, der höflich und respektvoll zu einem schwulen Kollegen ist, auch seine Einwände gegen die Homo-Ehe äußern darf. So funktioniert das System nicht mehr.“
Aber warum ist das so? Trueman legt dar, dass die führenden Evangelikalen in ihrem Versuch, das Christentum in den intellektuellen Eliten gesellschaftsfähig zu machen, einen entscheidenden Punkt übersehen haben, der in den letzten 30 Jahren immer deutlicher zutage getreten ist:
„Das Hochschulwesen ist heute weitgehend das Land der „Woken“. Man mag ein brillanter Biochemiker sein oder ein profundes Wissen über die minoische Zivilisation haben, aber jedes Abweichen von der kulturellen Orthodoxie in Bezug auf Rasse, Sexualität oder sogar bei anderen Begriffen wird sich bei Einstellungs- und Bleibeverhandlungen als wichtiger erweisen als Fragen nach der wissenschaftlichen Kompetenz und sorgfältiger Forschung. … Meine Studenten können die Realität sehr genau einschätzen. Die kultivierten Verächter des Christentums von heute halten dessen Lehren nicht für intellektuell unplausibel, sondern für moralisch verwerflich. Und das war schon immer zumindest teilweise der Fall. Das war der Punkt, den Noll und Marsden übersehen haben – auch wenn er in den neunziger Jahren am Wheaton College oder an der Universität von Notre Dame vielleicht nicht so offensichtlich war wie heute fast überall im Hochschulbereich.”
 Alisa Childers hat mit Holly Pivec und Dr. Doug Geivett über ihr Buch A New Apostolic Reformation?: A Biblical Response to a Worldwide Movement gesprochen. In ihrer Studie analysieren sie die Lehren der sogenannten New Apostolic Reformation-Bewegung (NAR). Sie diskutieren etwa über die spezielle Bibelübersetzung (Passion Bible), das Gebetskonzept und die Musik, die aus der Bethel-Bewegung von Bill Johnson kommt.
Alisa Childers hat mit Holly Pivec und Dr. Doug Geivett über ihr Buch A New Apostolic Reformation?: A Biblical Response to a Worldwide Movement gesprochen. In ihrer Studie analysieren sie die Lehren der sogenannten New Apostolic Reformation-Bewegung (NAR). Sie diskutieren etwa über die spezielle Bibelübersetzung (Passion Bible), das Gebetskonzept und die Musik, die aus der Bethel-Bewegung von Bill Johnson kommt.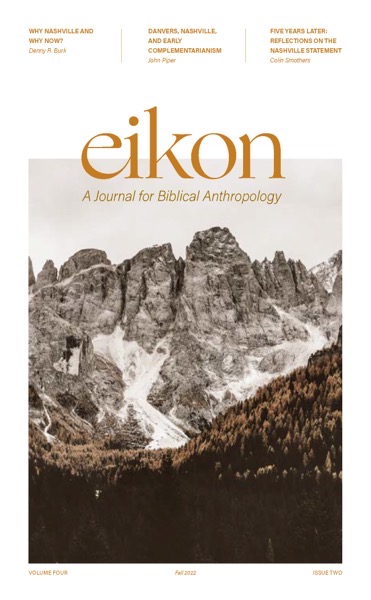 Im Journal EIKON ist ein kurzer Artikel zum fünfjährigen Jubiläum der Nashville-Erklärung erschienen. Ich versuche dort, die Entstehung und Wirkung der deutschen Übersetzung zu schildern:
Im Journal EIKON ist ein kurzer Artikel zum fünfjährigen Jubiläum der Nashville-Erklärung erschienen. Ich versuche dort, die Entstehung und Wirkung der deutschen Übersetzung zu schildern: Über 500 Jahre nach dem Beginn der Reformation trennen Protestanten und Katholiken noch immer enorme Unterschiede. Dennoch bestehen einige Vertreter beider Seiten darauf, dass die beiden Traditionen zusammenarbeiten und dass die Spaltungen endlich überwunden werden können. Viele evangelikale Christen sind unschlüssig. Wo sollte die Grenze gezogen werden?
Über 500 Jahre nach dem Beginn der Reformation trennen Protestanten und Katholiken noch immer enorme Unterschiede. Dennoch bestehen einige Vertreter beider Seiten darauf, dass die beiden Traditionen zusammenarbeiten und dass die Spaltungen endlich überwunden werden können. Viele evangelikale Christen sind unschlüssig. Wo sollte die Grenze gezogen werden? Das Buch
Das Buch