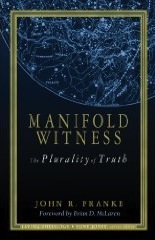Was ist evangelikaler Fundamentalismus?
Was ist Fundamentalismus? Und inwiefern kann man diesen Begriff auf konservative Christen anwenden? Gleich zwei Bücher sind vor kurzem zu diesem Thema erschienen. Der Theologe und Religionssoziologe Thomas Schirrmacher erklärt in seinem Buch, wie man sich selbst vor Fundamentalismus schützen kann. In der Broschüre des Theologen Reinhard Hempelmann (EZW-Texte 206) werden Herkunft und verschiedene Strömungen des Evangelikalismus analysiert. Beide Materialien stellt das Christliche Medienmagazin pro hier kurz vor: www.pro-medienmagazin.de.
Ich habe bisher nur das EZW-Heft von Dr. Hempelmann überfliegen können. Den historischen Teil finde ich, soweit gelesen, informativ und sachlich. Gern lass ich mir natürlich sagen (S. 35):
Im christlichen Fundamentalismus kommen Aspekte zum Tragen, die den Protestantismus von Anfang an bestimmt haben: die Orientierung am Wort Gottes (sola scriptura), die Konzentration auf das Elementare und Fundamentale, das unbedingte Vertrauen auf den einen Gott, der sich in Christus den Menschen zuwendet.
Dass das Zitieren von Bibelsprüchen »nicht selten zum Ersatz für das eigene Nachdenken« geworden ist, mag sein (S. 38). Leider finde ich neben vielen zutreffenden Beobachtungen auch theologische Vorurteile, wie zum Beispiel (S. 35):
Falsch an ihm [dem christlichen Fundamentalismus] ist, dass er die Vielfalt des biblischen Zeugnisses nicht hinreichend wahrnimmt, dass er die christliche Freiheit leugnet, dass er Stilfragen zu Grundsatzfragen macht. Falsch an ihm ist, dass er die Verbindung von Glaube und Vernunft nicht ausreichend berücksichtigt.
Auch der angeboten »Fundamentalismusbegriff« überzeugt mich nicht (S. 31):
Ein Grundprinzip fundamentalistischer Strömungen ist das Prinzip der Übertreibung. Einsichten des Glaubens werden so übertrieben, dass sie das christliche Zeugnis verdunkeln, ja verkehren. Dies bezieht sich zwar zuerst auf das gesteigerte Schriftprinzip – verbunden mit einem Verbalinspirationsdogma –, darüber hinaus aber auch auf andere Ausdrucksformen und Motive der Frömmigkeit.
Überraschend schwach finde ich folgenden Vorschlag (S. 38):
Um einen Wort- oder auch Geistfundamentalismus aufzubrechen und zu öffnen, bedürfte es einer tieferen Wahrnehmung des Verhältnisses von Wort und Geist. Der »Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig« (2. Kor 3,6), meinte Paulus. Fundamentalistische Strömungen sind blind für diese Unterscheidung zwischen Buchstabe und Geist, mit der Folge, dass die christliche Freiheit verdrängt, eingeschränkt und geleugnet wird.
War das das Anliegen von Paulus? War dieser »Aufbruch« die Errungenschaft des Protestantismus. Stellvertretend für andere zitiere ich hierzu Calvin (Institutio I, 9):
Wer die Schrift verwirft und sich dann irgendeinen Weg erträumt, um zu Gott zu kommen, der ist nicht eigentlich dem Irrtum, sondern der Raserei verfallen. So sind neuerdings einige Schwindelköpfe aufgetreten, die sich hochmütig für geisterfüllte Lehrer ausgeben — aber sie verachten alles Lesen der Schrift und machen sich über die Einfalt derer lustig, die nach ihrer Meinung an toten und tötenden Buchstaben hangen. Ich möchte nur fragen, was das denn für ein Geist sei, durch dessen Wehen sie so hoch daherfahren, daß sie die Lehre der Schrift als kindisch und unwesentlich zu verachten sich erkühnen! Sollten sie antworten, das sei Christi Geist, so ist das lächerliche Verblendung. Denn sie werden ja dann doch wohl zugeben, daß die Apostel Christi und die anderen Gläubigen in der Urkirche von keinem anderen Geiste erleuchtet gewesen sind. Aber dieser Geist hat keinen von ihnen die Verachtung des Wortes Gottes gelehrt, sondern sie haben nur größere Verehrung gelernt, wie ihre Schriften deutlichst bezeugen. So war es schon vom Propheten Jesaja vorhergesagt. Wenn er nämlich ausspricht: »Mein Geist, der in dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht von deinem Munde weichen noch von dem Mund deines Samens ewiglich« (Jes. 59,21), so bindet er das Volk des Alten Bundes nicht an eine äußerliche Lehre, als ob es noch in den Anfangsgründen steckte, nein, er lehrt, das werde das rechte und volle Heil der neuen Gemeinde unter der Herrschaft Christi sein, daß sie nicht weniger durch das Wort Gottes als durch den Geist regiert würde! Hier wird deutlich, daß jene Windbeutel in schändlichem Frevel auseinanderreißen, was der Prophet zu unverletzlicher Einheit verbunden hat. Man muß hierzu noch beachten, daß Paulus, der doch bis in den dritten Himmel entzückt worden ist, nicht aufhörte, in der Lehre des Gesetzes und der Propheten fortzu schreiten, wie er denn auch den Timotheus, einen Lehrer von so einzigartiger Vor bildlichkeit, zum Festhalten am Lesen der Schrift ermahnt (1Tim. 4,13). Und wie denkwürdig ist das Lob, das er der Schrift darbringt, wenn er sagt, sie sei »nützlich zur Lehre, zur Ermahnung, zur Besserung, daß ein Knecht Gottes vollkommen sei …« (2Tim. 3,16)! Was ist es doch für ein teuflischer Wahn, von einer bloß zeitlichen und vorübergehenden Geltung der Schrift zu phantasieren – wo sie doch die Kinder Gottes bis zum äußersten Ziele führt! Auch sollten doch jene Schwärmer angeben, ob sie eigentlich einen anderen Geist empfangen haben als den, den der Herr seinen Jüngern verheißen hat. Ich glaube zwar, daß sie vom tollsten Wahn gequält sind – aber das in Anspruch zu nehmen, so toll werden sie doch nicht sein! … Das Amt des Geistes, der uns verheißen ist, besteht also nicht darin, neue und unerhörte Offenbarungen zu erdichten oder eine neue Lehre aufzubringen, durch die wir von der überlieferten Lehre des Evangeliums abkommen müßten – sondern sein Amt ist eben, die Lehre in uns zu versiegeln, die uns im Evangelium ans Herz gelegt wird!