Wenn es nach den Wünschen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geht, soll das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) weiter verschärft werden. Dies erklärte Christine Lüders, die Vorsitzende der Behörde, während der Vorstellung eines Evaluierungsberichts am 9. August. Der Bericht geht auf Untersuchungen zur Wirksamkeit des AGG zurück und wurde von dem grünen Kommunalpolitiker Alexander Klose verfasst. Mehrere Politiker, unter ihnen Michael Fuchs (CDU), sprachen davon, dass es sich nicht um einen Evaluierungsbericht, sondern um einen Forderungskatalog handele. Gefordert werden nicht nur längere Klagefristen und ein Klagerecht für Verbände, sondern auch Quoten für Migranten und andere Minderheiten.
Dorothea Siems hat dankenswerter Weise für die WELT die Forderungen treffend kommentiert:
Doch jetzt bereiten die Verfechter der rigorosen Linie einen Coup vor. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, legt am Dienstag einen Evaluationsbericht vor, der es in sich hat.
Denn die von ihr beauftragten Gutachter halten die bisherigen Maßnahmen für völlig unzureichend. Weil zu wenige Betroffene vor Gericht ziehen, sollen künftig auch Verbände, Gewerkschaften und Betriebsräte sowie die Antidiskriminierungsstelle selbst klagen dürfen, heißt es in dem Bericht.
Überdies müsse der Gesetzgeber die Unternehmen viel stärker als bisher an die Kandare nehmen und nicht nur für Frauen eine Quote für Führungsposten und Gleichstellungspläne vorschreiben. Solche „proaktiven Gleichstellungsmodelle“ seien auch für Migranten (Link: http://www.welt.de/157014684) und andere Minderheiten zu erwägen – nicht nur für die Wirtschaft ist das eine Horrorvorstellung.
Dass der aus Steuergeldern finanzierte Evaluationsbericht kaum statistische Daten, aber dafür einen ellenlangen Forderungskatalog enthält, ist kein Zufall. Denn Lüders hat sich bewusst an eine Forschungsstelle gewandt, die einen radikalen Ansatz in der Antidiskriminierungspolitik propagiert.
Der Leiter des von ihr beauftragten „Büros für Recht und Wissenschaft“, Alexander Klose, wirbt schließlich als Fachreferent für Migrations- und Flüchtlingspolitik in der Fraktion der Berliner Grünen seit Jahren für einen scharf linken Kurs.
Mehr: www.welt.de.
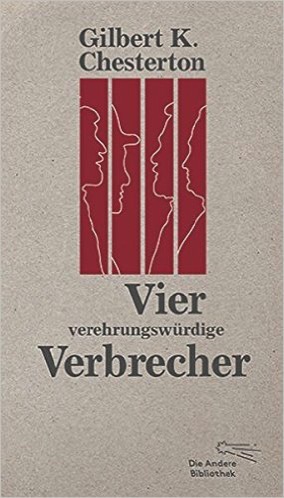 In Gilbert Keith Chestertons nun auf Deutsch erschienen Roman
In Gilbert Keith Chestertons nun auf Deutsch erschienen Roman