Zweimal im Jahr, nämlich zu Ostern und zu Weihnachten, erklären uns viele große Zeitschriften und Magazine die Bibel. Früher habe ich mich darüber geärgert, wenn z.B. DER SPIEGEL feststellte, die Autoren der alttestamentlichen Geschichtsschreibung hätten „Retrojektion eigener Großmachtträume in die Vergangenheit“ betrieben. Heute betrachte ich diese populärkritischen Artikel eher als Einladung, mal wieder zum Thema „Bibel“ ins Gespräch zu kommen.
 Das NEWSWEEK Magazin hat in seiner diesjährigen Weihnachtsausgabe den Artikel „The Bible: So Misunderstood It’s a Sin“ des Journalisten Kurt Eichenwald veröffentlicht. Ein gewaltiger Rundumschlag. Am Ende seines Beitrags fragt Eichenwald:
Das NEWSWEEK Magazin hat in seiner diesjährigen Weihnachtsausgabe den Artikel „The Bible: So Misunderstood It’s a Sin“ des Journalisten Kurt Eichenwald veröffentlicht. Ein gewaltiger Rundumschlag. Am Ende seines Beitrags fragt Eichenwald:
„Warum sollen wir die Bibel überhaupt noch studieren? Sie enthält Widersprüche, Übersetzungsfehler, wurde nicht von Augenzeugen geschrieben und ist mit Wörtern angereichert, die von unbekannten Schreibern eingefügt wurden, um der Kirche lehrmäßige Orthodoxie zu injizieren. Sollte sie nicht einfach aufgegeben werden?“
Ganz aufgeben will Eichenwald die Bibel dann doch nicht. Immerhin enthalte sie – ach, wie vorhersehbar – einen brauchbaren Appell zur Nächstenliebe.
Daniel B. Wallace hat sich die wichtigsten Argumente angeschaut und widerlegt. Nach der Erörterung des Vorwurfs, die Handschriften der Bibel seien so korrupt, dass wir gar nicht mehr wissen könnten, was damals passierte, schreibt er:
„Einer der bemerkenswertesten Abschnitte innerhalb der absurden Argumentation in Eichenwald Essay ist seine Erörterung zur Korruption der Handschriften. Jeder einzelne Vorwurf, den er erhebt, setzt voraus, dass er weiß, was der ursprüngliche Text sagte. Denn er behauptet, dass der Text in jedem Fall beschädigt worden war! Und mehr als einmal widerspricht er seiner Eröffnungslist, indem er mit Autorität auf das verweist, was der ursprüngliche Text tatsächlich gesagt hat. Kurz: Eichenwalds erster Absatz führt die Übertreibungen auf neue Höhen. Wenn es seine Absicht ist, konservative Christen zu beschämen, weil ihre Auffassungen realitätsfremd seien, sollte er sich vielleicht etwas Zeit nehmen, um in den Spiegel schauen.“
Hier sein Artikel: danielbwallace.com.
VD: JW
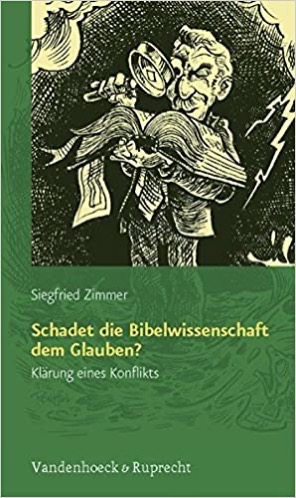 Warum man die Bibel mit gutem Wissen und Gewissen anders lesen kann als Siegfried Zimmer, beschreibe ich in dem Artikel „Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?“. Darin heißt es:
Warum man die Bibel mit gutem Wissen und Gewissen anders lesen kann als Siegfried Zimmer, beschreibe ich in dem Artikel „Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?“. Darin heißt es: Der niederländische Theologe Herman Bavinck sagte vor rund 100 Jahren über seine Kollegen Folgendes:
Der niederländische Theologe Herman Bavinck sagte vor rund 100 Jahren über seine Kollegen Folgendes:
 D.A. Carson erzählt in dem TGC-Beitrag
D.A. Carson erzählt in dem TGC-Beitrag  Daniel Facius hat ein schönes Buch herausgegeben. Es soll interessierten Christen die Gelegenheit geben, die Position des Bibelbundes zu verschiedenen, die Bibel betreffenden Fragen, kennenzulernen. Mitglieder und Freunde des Bibelbundes haben hierfür Aufsätze verfasst, um diese grundlegenden Positionen verständlich zu vermitteln.
Daniel Facius hat ein schönes Buch herausgegeben. Es soll interessierten Christen die Gelegenheit geben, die Position des Bibelbundes zu verschiedenen, die Bibel betreffenden Fragen, kennenzulernen. Mitglieder und Freunde des Bibelbundes haben hierfür Aufsätze verfasst, um diese grundlegenden Positionen verständlich zu vermitteln. Das NEWSWEEK Magazin hat in seiner diesjährigen Weihnachtsausgabe den Artikel „The Bible: So Misunderstood It’s a Sin“ des
Das NEWSWEEK Magazin hat in seiner diesjährigen Weihnachtsausgabe den Artikel „The Bible: So Misunderstood It’s a Sin“ des