Die Dreiteilung des alttestamentlichen Gesetzes
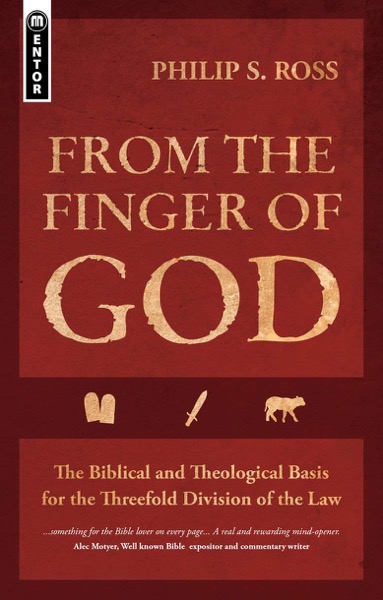
Die klassische Dreiteilung des alttestamentlichen Gesetzes wird heute von vielen Theologen abgelehnt, mitunter auch von jenen, die in der Tradition der reformierten Theologie stehen. Zumindest sind viele gegenüber dieser Unterscheidung misstrausch.
Um ein Beispiel zu nennen: D.A. Carson hält es für möglich, dass sich die Kategorien Moralrecht, Zivilrecht und Zeremonialgesetz aus der Schrift entwickeln lassen – auch wenn sie dort nicht ausdrücklich gelehrt werden. Aber diese Unterscheidung ist problematisch, wenn wir sie a priori in die Schrift eintragen. Er schreibt („Mystery and Fulfillment: Toward a More Comprehensive Paradigm of Paul’s Understanding of the Old and the New“, in: P.T. O’Brien u. M.A. Seifrid (Hrsg.), Justification and Variegated Nomism: The Paradoxes of Paul, Bd. 2, Baker Academic; Tübingen: Mohr Siebeck u. Grand Rapids, MI: Baker Academics, 2004, S. 429):
Kurz gesagt, das Problem mit der Dreiteilung des Gesetzes, die als Mittel zur Erklärung von Kontinuität und Diskontinuität zwischen den Testamenten auf Thomas von Aquin zurückgeht, besteht darin, dass sie versucht, ein apriorisches Raster zu konstruieren, um herauszufinden, welche Teile des Gesetzes Christen halten oder tun müssen, und dass sie davon ausgeht, dass Paulus ein solches Raster übernommen haben muss, auch wenn er es nicht ausdrücklich nennt. Wenn wir uns stattdessen in dieser Hinsicht enger an die paulinische Terminologie halten, können wir immer noch sinnvollerweise von der Dreiteilung aus einer a posteriori-Perspektive sprechen: Nachdem wir die Muster von Kontinuitäten und Diskontinuitäten, die Paulus aufstellt, beobachtet haben, können jene Gesetze des alten Bundes, die Christen in einer Weise „erfüllen“, die ihrer Funktion innerhalb des alten Bundes am ehesten entspricht, sicher als „moralisch“ bezeichnet werden, ohne zu befürchten, dass eine a priori-Definition Paulus‘ Denken domestiziert.
Das Buch From the Finger of God: The Biblical and Theological Basis for the Threefold Division of the Law von Philip S. Ross untersucht die biblische und theologische Grundlage für die klassische Unterteilung des alttestamentlichen Gesetzes. Es beleuchtet einige der Auswirkungen dieser Unterteilung auf die Lehre von der Sünde und der Sühne und kommt zu dem Schluss, dass die Theologen diese Unterteilung zu Recht als in der Heiligen Schrift verwurzelt und die Zehn Gebote als ewig verbindlich ansahen.
Auch für jene, die die Dreiteilung ablehnen, liefert das Buch eine solide Darstellung und Erklärung der alten Differenzierung. Es verfolgt die Spuren nicht nur zurück bis zu den Kirchenvätern, sondern sucht schon im Judentum nach Indizien und macht dafür Anleihen bei den Untersuchungen von Walter Kaiser (S. 20):
Kaiser weist darauf hin, dass die Suche nach den Ursprüngen der Dreiteilung, die bei den Kirchenvätern endet, nicht weit genug zurückreicht. Obwohl er nicht behauptet, dass sie von den Rabbinern stammt, zitiert er Montefiores und Dalmans Zeugnis über die Unterscheidung zwischen „schweren“ und „leichten“ Geboten durch die Rabbiner.
Wenn Montefiore recht hat, kannten die Rabbiner die Unterscheidung zwischen zeremoniellen und moralischen Geboten, und im Großen und Ganzen betrachteten sie die „moralischen“ als wichtiger und grundlegender als die „zeremoniellen“ – sie akzeptierten eine Zweiteilung. Dies mag den Grundstein für den von einigen Kirchenvätern bevorzugten Ansatz gelegt haben, und in späteren Kapiteln wird sich zeigen, dass der Vorrang des „moralischen“ Gesetzes eine fest etablierte Ansicht war.
[#ad]
 D.A. Carsons Buch Die komplexe Lehre von der Liebe Gottes ist nun endlich auch in deutscher Sprache erhältlich. Das Buch geht auf Vorträge zurück, die Carson im Februar 1998 am Dallas Theological Seminary gehalten hat. Erörtert werden Fragen wie: Kann Gott angesichts seiner Unveränderlichkeit Gefühle haben? Wie verhält sich die Liebe Gottes zu seiner Souveränität und zu seinem Zorn?
D.A. Carsons Buch Die komplexe Lehre von der Liebe Gottes ist nun endlich auch in deutscher Sprache erhältlich. Das Buch geht auf Vorträge zurück, die Carson im Februar 1998 am Dallas Theological Seminary gehalten hat. Erörtert werden Fragen wie: Kann Gott angesichts seiner Unveränderlichkeit Gefühle haben? Wie verhält sich die Liebe Gottes zu seiner Souveränität und zu seinem Zorn? D.A. Carson hat das Buches
D.A. Carson hat das Buches 
 Dr. D.A. Carson ist renommierter Neutestamentler und unterrichtet seit 1978 an der Trinity Evangelical Divinity School. Carson ist Gründungsmitglied der Gospel Coalition, einem reformierten Netzwerk in Nordamerika. Außerdem ist er weltweit als Gastdozent und Redner unterwegs. Dr. Carson ist Herausgeber der Pillar-Kommentarreihe über das Neue Testament sowie Autor zahlreicher anderer Bücher. Unter anderem hat er das empfehlenswerte Buch Herr, wie lange noch?!, verfasst.
Dr. D.A. Carson ist renommierter Neutestamentler und unterrichtet seit 1978 an der Trinity Evangelical Divinity School. Carson ist Gründungsmitglied der Gospel Coalition, einem reformierten Netzwerk in Nordamerika. Außerdem ist er weltweit als Gastdozent und Redner unterwegs. Dr. Carson ist Herausgeber der Pillar-Kommentarreihe über das Neue Testament sowie Autor zahlreicher anderer Bücher. Unter anderem hat er das empfehlenswerte Buch Herr, wie lange noch?!, verfasst. D.A. Carson erzählt in dem TGC-Beitrag
D.A. Carson erzählt in dem TGC-Beitrag