Betörte Anbetung
Starke Aussage, ungefähr so: „Betörte Anbetung ist nicht so sehr ein Problem der falschen Methode oder des falschen Stils, sondern das eines falschen Gottes.“
Starke Aussage, ungefähr so: „Betörte Anbetung ist nicht so sehr ein Problem der falschen Methode oder des falschen Stils, sondern das eines falschen Gottes.“
Kürzlich hat der Neutestamentler D.A. Carson in Themelios das Evangelium erklärt, also gesagt, was das Evangelium ist und was es nicht ist. Hier ein Interview, in dem er ebenfalls über das Wesen des Evangeliums spricht:
Vorträge von D.A. Carson mit deutscher Übersetzung können auf der Internetseite von Evangelium21 abgerufen werden: www.evangelium21.net.
Pünktlich zur Woche der Toleranz eine wichtige Mitteilung: Das Buch The Intolerance of Tolerance von Donald A. Carson ist in deutscher Sprache beim 3L-Verlag erschienen. Im Frühjahr hatte Hanniel das Buch hier im TheoBlog besprochen und schrieb:
Das Buch ist ein händeringendes Plädoyer und „Beknien“ des Lesers: Lass dir die Augen öffnen über die fatale Neudefinition des Toleranzbegriffs. Werde dir bewusst, was dieser Wandel für die Christen bedeutet. Insofern passt das letzte Kapitel mit acht inhaltlichen Denk- und Handlungsempfehlungen überein. Es ist eine Aufgabe des Christen, auf die Fallen des neuen Toleranzverständnisses hinzuweisen. Eine Massnahme ist eben das Schreiben dieser Buchbesprechung. Ich werde mich künftig noch besser auf einzelne Pressemeldungen aus europäischen Zeitungen achten, um entsprechende hiesige Belege zu sammeln. Carson ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Aufklärungsarbeit jedoch nicht das prioritäre Ziel des Christen darstellt. Vielmehr geht es darum, mutig hinzustehen und das Evangelium zu verkündigen. Wie soll das geschehen? Durch Debatte und Abwägen von Argumenten, ohne Druck, aber mit viel Entschiedenheit. Wer nämlich wirklich tolerant sein will, der muss selbst über feste Überzeugungen verfügen.
Das Buch gibt es hier: www.amazon.de.
Hier ein hochkarätig besetztes Plenum zu dem heißen Thema „Mann und Frau“. Konkret geht es um das komplementäre Rollenverständnis. Das Gespräch fand am 7. Juni 2014 statt. Teilnehmer sind Kathy Keller, Tim Keller, Kathleen Nelson und John Piper. Don Carson moderiert das Gespräch.
Hanniel hat das Buch:
gelesen. Hier eine kurze Buchbesprechung, die Hanniel freundlicherweise zur Verfügung stellt:
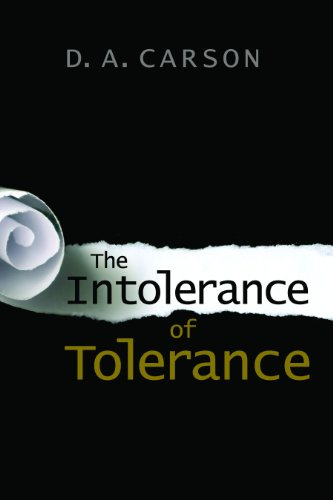 Die Intoleranz der Toleranz
Die Intoleranz der ToleranzCarson sieht das Buch als inhaltliche Ergänzung zu „Christ and Culture Revisited“. Bereits in seinem umfangreichen Werk zum religiösen Pluralismus („The Gagging of God“) hatte er auf das veränderte Toleranzverständnis hingewiesen. In diesem vergleichsweise kurzen Buch nimmt er den Faden auf. Das erste Kapitel dient dazu, den Rahmen für die Entwicklung der These abzustecken. In den nächsten beiden Kapiteln geht es darum, die These anhand von Beispielen aus der US-Rechtsprechung zu konkretisieren und die historische Entwicklung des Begriffs seit den Griechen nachzuvollziehen. Im vierten Kapitel wird der Anspruch der neuen Toleranz, nämlich ethisch und moralisch „auf neutralem Boden“ zu stehen, gründlich entkräftet. Das Buch wäre unvollständig, wenn der Bogen zum Wahrheitsbegriff (5. Kapitel) und zur Realität des Bösen in der Welt (6. Kapitel) nicht geschlagen worden wäre. Genau so ist Carson bestrebt, mit der von vielen Christen gehegte idealistische Vorstellung von Demokratie aufzuräumen, indem er einen Blick auf das aktuelle Weltgeschehen wirft.
Carson geht es im ganzen Buch um die eine Hauptsache: Den neuen Toleranzbegriff zu hinterfragen, als unbrauchbar zu entlarven und den Leser gedanklich zum herkömmlichen Verständnis des Begriffs zurückzuführen. Insofern ist dieses Buch „kreisförmig“ aufgebaut. Die These wird von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Jede einzelne Perspektive wird mit einer Fülle aktueller Beispiele (aus den USA) untermauert. Wie es für Carson typisch ist, lohnt es sich auch die Fussnoten zu lesen. Dort gibt es Dutzende von Hinweisen auf aktuelle Literatur. Bei mindestens zehn Büchern habe ich ein „Q“ für „Quelle“ hingeschrieben. Einzelne Bücher setzte ich auf meine Leseliste.
Alte und neue Toleranz: Durch das Buch erhielt ich ein vertieftes Bewusstsein darüber, wie tief der Graben zwischen der alten und der neuen Toleranz ist. Mit der neuen Toleranz verbunden ist der einengende Leitsatz, dass alle Religionen und Überzeugungen gleichwertig nebeneinander zu stehen haben. Wie absurd diese Behauptung ist, wird schon daran deutlich, dass darunter Ideologien wie der Nationalsozialismus oder der Stalinismus fallen würden. In der Realität kommen die Vertreter nicht darum herum, einige wenige Überzeugungen anderen vorzuziehen. Vornehmlich im Schussfeld der Kritik stehen christliche Überzeugungen. Wer sich diskriminiert fühlt, kann ohne erhebliche Hindernisse Behörden in Aufregung und Agitation versetzen. Ein solches Vorgehen erstickt nicht nur den akademischen Diskurs. Er schränkt die Meinungsvielfalt drastisch ein.
Die Behauptung der Neutralität: Die neue Toleranz steht mitnichten auf neutralem Grund und Boden. Weil sie einige Überzeugungen bevorzugen muss, wird sie dem eigenen Anspruch nach Gleichbehandlung untreu. Es ist unumgänglich, einen moralischen Standpunkt einzunehmen.
Das Argument der Überheblichkeit: Wer einmal die Seite wechselt (und als Christ wäre es sinnvoll, sich in einen Bürger eines Staates ausserhalb der westlich-säkularen Welt zu versetzen), dem wird die Arroganz der neuen Toleranz vor Augen geführt. Wer dem säkularen Leitsatz nicht zustimmen kann, weil er einer anderen Religion angehört, wird automatisch degradiert. Ganz zu schweigen von der Behauptung, dass alle Religionen die gleichen Aussagen treffen bzw. sich in ihrer Substanz nicht voneinander unterscheiden würden.
Die Optionen für Religionsfreiheit: Carson stellt verschiedene Varianten der Religionsfreiheit dar. Variante A: Jeder darf denken, was er will; die Ausübung der Religion wird jedoch stark kontrolliert. Variante B: Bürger dürfen nicht nur ihre eigenen Überzeugungen haben, sondern sich auch mit Gleichgesinnten treffen. Verboten ist das Evangelisieren. Variante C: Bürger dürfen sich nicht nur treffen, sondern ihre Überzeugung auch offen propagieren. Allerdings dürfen sie in öffentlichen Angelegenheiten keine religiösen Gründe anführen. Variante D: Jeder Bürger, ob religiös oder nicht, hat die Verantwortung, seine moralische Weisheit, wie sie auch immer geartet ist, in die öffentliche Diskussion einzubringen. Nur Variante D ist mit dem herkömmlichen Toleranzbegriff wirklich kompatibel.
Die Gefahren der Demokratie: Wie stark die neue Toleranz dem Totalitarismus des Staates in die Hände spielt, wurde mir erst bei der Lektüre so richtig bewusst. Wo der einzelne Bürger seine Überzeugungen nicht geltend machen kann (und diese Überzeugungen orientieren sich am besten an einer überstaatlichen Autorität), springt der Staat in die Lücke.
Es kann ein einheitliches Muster für Diskriminierung abgeleitet werden. Im Namen der neuen Toleranz wird eine Person bzw. Organisation der Intoleranz bezichtigt und dadurch selbst diskriminiert. Carson berichtet von Ärzten, die verklagt oder ausgeschlossen werden, weil sie selber keine Abtreibungen vornehmen wollen (auch wenn sie anderen das Recht zugestehen). Ganz ähnlich geht es dem Professor, der in einer Debatte über die Palästinenser über geschichtliche Details diskutieren wollte. Im Nu entstand eine hitzige Diskussion unter Studenten, und prompt fühlte sich jemand diskriminiert. Es kam zur Anzeige und zur Entlassung des Dozenten. Oder was soll man vom Verbot halten, einen Vater an einer Schule darüber berichten zu lassen, wie er den Tod seines Sohnes verarbeitet hat – wobei er auf seinen Glauben Bezug zu nehmen gedachte? An diesen und vielen weiteren Beispielen wird deutlich, dass mit der neuen Toleranz die Vielfalt von Meinungen eingeschränkt sowie Diskussion und Argumentation verunmöglicht wird.
Das Buch ist ein händeringendes Plädoyer und „Beknien“ des Lesers: Lass dir die Augen öffnen über die fatale Neudefinition des Toleranzbegriffs. Werde dir bewusst, was dieser Wandel für die Christen bedeutet. Insofern passt das letzte Kapitel mit acht inhaltlichen Denk- und Handlungsempfehlungen überein. Es ist eine Aufgabe des Christen, auf die Fallen des neuen Toleranzverständnisses hinzuweisen. Eine Massnahme ist eben das Schreiben dieser Buchbesprechung. Ich werde mich künftig noch besser auf einzelne Pressemeldungen aus europäischen Zeitungen achten, um entsprechende hiesige Belege zu sammeln. Carson ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Aufklärungsarbeit jedoch nicht das prioritäre Ziel des Christen darstellt. Vielmehr geht es darum, mutig hinzustehen und das Evangelium zu verkündigen. Wie soll das geschehen? Durch Debatte und Abwägen von Argumenten, ohne Druck, aber mit viel Entschiedenheit. Wer nämlich wirklich tolerant sein will, der muss selbst über feste Überzeugungen verfügen!
Auf der Evangelium21-Konferenz 2012 gehörte der Neutestamentler Don Carson zu den Hauptrednern. Hier sein Vortrag über Psalm 1. Übersetzt wird D.A. Carson von Kai Soltau (die Anmeldungen für die Konferenz 2014 laufen hier).
Schon einmal D.A. Carson auf Deutsch gehört?
Mehr Informationen über das Studienzentrum in München hier: www.bucer.de.
Das neue Buch von D.A. Carson heißt: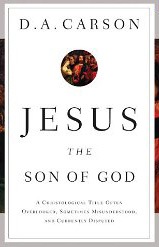
Der Verlag schreibt:
Although it is a foundational confession for all Christians, much of the theological significance of Jesus’s identity as “the Son of God” is often overlooked or misunderstood. Moreover, this Christological concept stands at the center of today’s Bible translation debates and increased ministry efforts to Muslims. New Testament scholar D. A. Carson sheds light on this important issue with his usual exegetical clarity and theological insight, first by broadly surveying Jesus’s biblical name as “the Son of God,“ and then by focusing on two key texts that speak of Christ’s sonship. The book concludes with the implications of Jesus’s divine sonship for how modern Christians think and speak about Christ, especially in relation to Bible translation and missionary engagement with Muslims across the globe.
Thabiti Anyabwile, ehemaliger Muslim, heute Pastor und beliebter Redner, empfiehlt das Buch mit folgenden Worten:
I know what it is to reject Jesus as the ‘Son of God.’ As a former Muslim, nothing baffled and, quite frankly, angered me more than hearing Christians call Jesus ‘the Son of God.’ I thought such persons were blasphemers worthy of condemnation. But now, nothing gives me more joy than to know that Jesus is indeed the Son of God and that the title ‘Son of God’ carries far more truth and wonder than I could have imagined. So I welcome this volume from D.A. Carson with all the enthusiasm and joy of one who once denied the truth that Jesus is the Son of God. With his customarily clear, warm, careful, and balanced manner, Carson gives us a fresh exploration of a precious truth that so many Christians take for granted and so many Muslims misunderstand. If you want to know Jesus and the Bible better, this surely is one aid that will not disappoint.
Eine Kostprobe aus dem Buch gibt es hier: jesus-the-son-of-god-download.pdf.
Wer ist der größere Sünder: R.C. Sproul oder D.A. Carson? Über diese und bedeutungsvollere exegetische Fragen haben sich Sproul und Carson vor ungefähr einem Jahr unterhalten. Hier ist das Ergebnis:
RC Sproul interviews DA Carson on biblical exegesis from Ligonier on Vimeo.
VD: JO
Heute sind allerlei „Evangeliumsdefinitionen“ im Umlauf. Manche Christen reduzieren z.B. das Evangelium auf ihre Errettung. Andere glauben, Evangelium will von uns heute gelebt werden, ist also etwas, was wir tun.
Was ist das Evangelium? Eine guter Einstieg für eine Beantwortung der Frage ist ein Wortstudium zur Begriffsfamilie um εὐαγγέλιον. Wenn dieses Wortstudium von dem Neutestamentler D.A. Carson stammt, kann das ja nur ein Lesevergnügen sein.
This essay is … also the beginning of a fresh probe into the subject by looking at “gospel” words—at εὐαγγέλιον and cognates. In my mind this is part of two larger projects aimed at showing (a) how the New Testament relates these gospel words to a wide swath of theological and pastoral themes and (b) how we would be wiser to stop talking so much about what “evangelicalism” is without deeper reflection on what the “evangel” is, what “the gospel” is. Those larger projects are merely hinted at in this chapter, of course.