Das Studium des Neuen Testaments neu aufgelegt
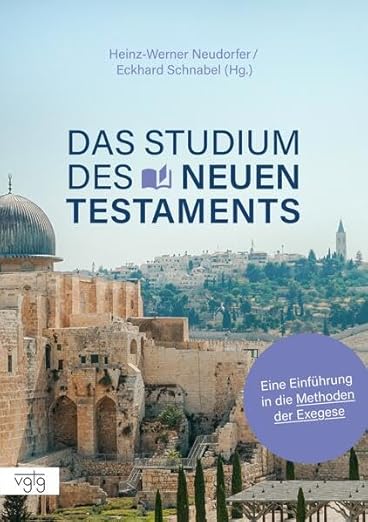
Das hilfreiche Werk Das Studium des Neuen Testaments ist beim Verlag VGTG neu erschienen. Das ist eine gute Nachricht, vor allem für Theologiestudenten und Pastoren. Tanja Bitter hat den Klassiker für Evangelium21 vorgestellt:
Wie der Titel schon erwarten lässt, handelt es sich um ein Lehrbuch, das Theologiestudenten mit den einzelnen Schritten bzw. mit wichtigen Aspekten der neutestamentlichen Exegese bekannt macht. Die Herausgeber, Heinz-Werner Neudorfer und Eckhard Schnabel, haben dafür elf weitere Theologen mit ins Boot genommen, die jeweils einzelne Kapitel beisteuern. Das Buch ist also nicht „aus einem Guss“, sondern ein Sammelband mit Beiträgen unterschiedlicher Autoren.
Im Eröffnungskapitel vermitteln die beiden Herausgeber einen Überblick über Die Interpretation des Neuen Testaments in Geschichte und Gegenwart. Dabei verweisen sie unter anderem auf die problematischen Denkvoraussetzungen der historisch-kritischen Exegese sowie deren Ergebnisse: „Die historische Kritik hat in vielen Haupt- und Nebenfragen eine Vielfalt einander widersprechender Ergebnisse hervorgebracht“ (S. 23). Diese Erkenntnis ist durchaus in der Fachwelt angekommen (vgl. bereits Albert Schweitzers Untersuchung der Leben-Jesu-Forschung), obwohl das historisch-kritische Vorgehen nach wie vor als unverzichtbar gilt. Vor diesem Hintergrund schwankt die Auslegung mittlerweile zwischen Ratlosigkeit und Experimentiergeist. Wo sich kaum mehr etwas mit Sicherheit sagen lässt, ist der Ausleger in seiner Subjektivität gefangen und die Bibel wird zu einem Buch ohne ermittelbare Botschaft.
Demgegenüber verfolgen die Herausgeber eine Hermeneutik, „die dem Charakter der Bibel gerecht wird, … die sich der (An-)Erkenntnis Gottes des Schöpfers, Richters und Erlösers beugt und den Offenbarungsanspruch der Bibel als Wort dieses Gottes anerkennt“ (S. 25). Das schließt gründliche grammatisch-historische Forschungsarbeit nicht aus, sondern ein, denn Gott hat uns sein Wort im Kontext einer realen historischen Situation und in konkreter literarischer Form gegeben.
Mehr: www.evangelium21.net.
[#ad]
 Das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament (ThWNT), der sogenannte „Kittel“, wird digital unter Logos verfügbar verfügbar gemacht. Das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament ist ein grundlegendes Werk für die Exegese des Neuen Testaments. Es gilt als ein exegetisches Jahrhundertwerk, dessen Fertigstellung mehr als 45 Jahre in Anspruch nahm. Es unternimmt den monumentalen Versuch, den Gebrauch und die Bedeutung aller religiös oder theologisch bedeutsamen Vokabeln im Neuen Testament erschöpfend zu analysieren. Die digitale Ausgabe füllt eine wichtige Lücke, die die lange vergriffene Studienausgabe hinterlassen hat. Bücher wie das ThWNT lassen sich in Logos auch einzeln erwerben und in der Software kostenlos auf allen gängigen Plattformen benutzen.
Das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament (ThWNT), der sogenannte „Kittel“, wird digital unter Logos verfügbar verfügbar gemacht. Das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament ist ein grundlegendes Werk für die Exegese des Neuen Testaments. Es gilt als ein exegetisches Jahrhundertwerk, dessen Fertigstellung mehr als 45 Jahre in Anspruch nahm. Es unternimmt den monumentalen Versuch, den Gebrauch und die Bedeutung aller religiös oder theologisch bedeutsamen Vokabeln im Neuen Testament erschöpfend zu analysieren. Die digitale Ausgabe füllt eine wichtige Lücke, die die lange vergriffene Studienausgabe hinterlassen hat. Bücher wie das ThWNT lassen sich in Logos auch einzeln erwerben und in der Software kostenlos auf allen gängigen Plattformen benutzen.