Polylove
Sex mit mehreren Partnern, vertraglich arrangiert. Gelegenheits-Sex ohne Verpflichtung oder Sex nach dem Terminkalender: Immer mehr Paare handeln ihre Beziehungen künftig völlig neu aus. Verbindlich ist die Unverbindlichkeit. In dem DIE WELT-Beitrag „Polyamore Beziehungen mit vielen sind die Zukunft“ heißt es:
„Liebes-Praktiken, die lange als Sittenverfall stigmatisiert wurden, rücken von den Rändern der Gesellschaft in den Mainstream“, sagte der Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, Andreas Steinle, in Kelkheim bei Frankfurt. „Verpflichtende Moralvorstellungen wie sie seitens der Kirchen formuliert werden, lassen mit der Individualisierung nach.“
Und Holm Friebe schreibt für das Monatsmagazin Trend-Update:
Schon Michel Foucault hat darauf hingewiesen, dass das öffentliche Reden über Sexualität und die mediale Präsenz des Themas nicht zu verwechseln sind mit einer emanzipierten gesellschaftlichen Praxis im Gebrauch der Lüste – und dass wir in dieser Beziehung eigentlich noch immer verklemmte Viktorianer sind. Aber es tut sich etwas, nicht nur im öffentlichen Diskurs, auch bei den praktizierten Modellen. An die Stelle allgemeiner Sitten- und Moralvorstellungen treten individuelle Arrangements. „Machen Sie sich frei!” gilt nicht mehr nur beim Doktor.
Die Verschiebungen im Spannungsfeld von Liebe, Sex und Partnerschaft stehen im Zentrum größerer Trend-Komplexe wie dem Wandel der Familie oder der Neujustierung von Geschlechterrollen. Auch wenn sie anfangs oft nur von kleinen Minderheiten adaptiert und praktiziert werden, sind sie doch Seismographen für kommende Beben, die die ganze Gesellschaft erfassen können. Im Zuge der gesellschaftlichen Liberalisierung wandern Praktiken, die lange als Perversion gebrandmarkt waren, und Paarmodelle, die als Sittenverfall stigmatisiert wurden, immer weiter in den Mainstream.
Hier geht es zum Leitartikelartikel „Polylove – Die neue Vielfalt von Geschlechterrollen, Partnerschaft und Sex“.
Na, wie viele Seelen werden da wohl auf der Strecke bleiben? Und: Wie viele der Polylover wünschen sich ganz tief in ihrem Innern eine vertrauensvolle und performanzunabhängige Partnerschaft, ein Gegenüber, von dem sie wissen, dass sie angenommen sind, mit all ihren Defiziten?
Übrigens: Der emergente Tony Jones, inzwischen Dozent am Fuller Seminar, ist wieder ganz nah am Zeitgeist, wenn er an einer christlichen Ethik für polyamore Beziehungstypen arbeitet. Vielleicht eröffnet sich ja ein neuer Markt, so im Sinne von: „Polylove mit Jesus“.
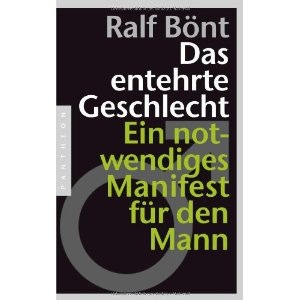 Wie der Titel des Buches verrät, ist darin die Abwertung des Mannes das vorrangig behandelte Problem. „Die Rolle des Mindermenschen wird ihm zugewiesen“, urteilt Bönt, er gelte als „Wegwerfwesen“, das beispielsweise in Beruf und Krieg leichtfertig geopfert wird, um eine für beide Geschlechter lebenswertere Welt herbeizuführen. Dabei hat sich, wie Bont ausführt, die Verachtung gegenüber Männern bis zur Gegenwart nur noch verstärkt. Ihre Sexualität beispielsweise gelte „in Nachrichten und Unterhaltung entweder als das Lächerliche oder als das Böse schlechthin“. Es entsteht eine Kultur des Dauerverdachts: Väter, die auf Spielplätzen anwesend sind, schildert Bönt am Beispiel eines konkreten Falles, werden als Triebtäter verdächtigt und müssen sich von Polizisten befragen lassen, die von besorgten Frauen alarmiert wurden. Amerikanische Firmen gehen inzwischen so weit, jeden Angestellten schriftlich darauf hinzuweisen, den Fahrstuhl zu verlassen und die Treppe zu nehmen oder auf den nächsten zu warten, wenn er sonst allein mit einer Frau in der Kabine führe.
Wie der Titel des Buches verrät, ist darin die Abwertung des Mannes das vorrangig behandelte Problem. „Die Rolle des Mindermenschen wird ihm zugewiesen“, urteilt Bönt, er gelte als „Wegwerfwesen“, das beispielsweise in Beruf und Krieg leichtfertig geopfert wird, um eine für beide Geschlechter lebenswertere Welt herbeizuführen. Dabei hat sich, wie Bont ausführt, die Verachtung gegenüber Männern bis zur Gegenwart nur noch verstärkt. Ihre Sexualität beispielsweise gelte „in Nachrichten und Unterhaltung entweder als das Lächerliche oder als das Böse schlechthin“. Es entsteht eine Kultur des Dauerverdachts: Väter, die auf Spielplätzen anwesend sind, schildert Bönt am Beispiel eines konkreten Falles, werden als Triebtäter verdächtigt und müssen sich von Polizisten befragen lassen, die von besorgten Frauen alarmiert wurden. Amerikanische Firmen gehen inzwischen so weit, jeden Angestellten schriftlich darauf hinzuweisen, den Fahrstuhl zu verlassen und die Treppe zu nehmen oder auf den nächsten zu warten, wenn er sonst allein mit einer Frau in der Kabine führe.