Eigentlich war die Postmoderne ein Aufstand der Designer gegen das strenge Schwarzgrau der großen Utopie der Moderne. Doch dann lief der Stil aus dem Ruder. Inzwischen hat die Postmoderne einen so schlechten Ruf, dass ihre Stars nicht damit ins Museum wollen. Für die aktuelle Ausstellung »Postmodernism: Style and Subversion 1979 – 1990« (siehe auch hier) war es schwer, Aussteller zu finden.
Catrin Lorch schreibt für die SZ:
Doch warum gilt die Postmoderne, zu deren ersten Vertretern neben Alessandro Mendini und Philippe Starck auch Rem Kohlhaas als Theoretiker gehört, heute als Sündenfall? Schon Ettore Sottsass äußerte sich nie wieder öffentlich zu Memphis, nachdem er sich 1985 aus der von ihm begründeten Designer-Gruppe zurückgezogen hatte.
Nun ist es mit dem Design – im Gegensatz zu Literatur, die vergriffen ist, oder Popmusik, die nicht mehr gespielt wird – ja so, dass die Dinge immer noch herumstehen, vom symmetrisch ausgeschnittenen Wolkenkratzergiebel bis zur verkachelten Säule und dem grasgrünen Tympanon an der Museumsfront. Und die Postmoderne hinterließ keine stillen Artefakte, sondern trumpfte auf, stolz, pseudoklassisch, wie die schmalen Krawatten, die romantische New Wave-Musik und die schlagerlaute Neue Deutsche Welle, die gleichzeitig in Mode kamen.
Diese aber sind längst abgehängt, aussortiert, höchstens noch im Nachtprogramm zu hören. Denn dem postmodernem Befreiungsschlag gegen Tabus und Verbindlichkeiten der Aufbaujahre, der wie ein Blitz in das fuhr, was als guter, demokratischer Geschmack galt, haftete immer auch etwas Restauratives an. Es ging plötzlich wieder um architektonische Monumentalität, die als Wert an sich gelten sollte. Der Turm ist hoch, weil er wichtig ist.
Ganz ungeniert wurde wieder Marmor gebrochen und Glas bunt gefärbt – und wem das zu teuer war, der arbeitete mit Laminat und Folie. Dieser geltungshuberische Eklektizismus blieb schon damals stumm, es war den Designern ja schon zu ihrem Vatermord an der großen Utopie der Moderne nicht viel mehr eingefallen, als dem Begriff eine Silbe, das »Post«, voranzustellen.
Anfang der Achtziger hatte die Postmoderne sich im Recht gewähnt, weil Funktionalismus und Neue Sachlichkeit in Zweckbauten geendet waren, in rechtwinkligen Variationen von Stahl, Beton, Glas. Schnell aber wurde klar, dass die neuen Werke umso fatalere Folgen hatten: Salonfähig wurde nicht die Ironie, die Albernheit, sondern der Salon selbst. Es waren nicht nur die Mickey-Maus-Ringel am Ohrensessel, die sich verkauften, der Baumarkt griff auch nach marmorierter Folie und falschen Säulen. Weitsichtig soll Dieter Ramms schon 1981 in Mailand geknurrt haben, dass er sich »jetzt schon vor den Kopien fürchtet«.
Die Postmoderne, das ist rückblickend ein plumper, bunter Historismus, der vor allem alte Hoheitsformeln reaktivierte. Und genau da gründet das Unbehagen von einstigen Vordenkern der Bewegung wie Rem Kohlhaas, die sich jetzt nicht mehr zugehörig fühlen mögen. Den Postmodernen geht es wie den Popeln, die auf Fotos zeigen und behaupten, da seien sie jung gewesen. Dabei wirkt das, was man sieht, bei aller Asymmetrie doch nur wertkonservativ.
Mehr: www.sueddeutsche.de.
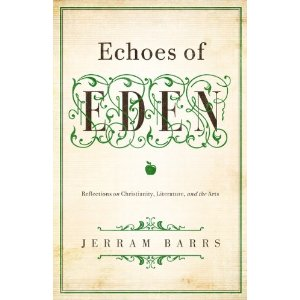 Jerram Barrs befasst sich in seinem neuen Buch:
Jerram Barrs befasst sich in seinem neuen Buch: