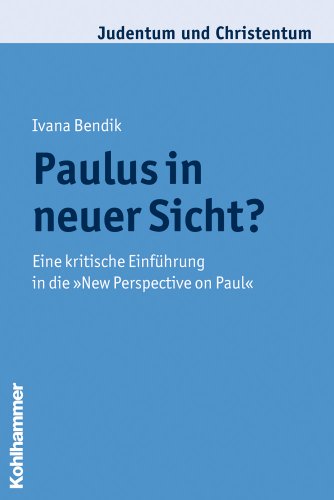 Mit der „Neue Paulusperspektive“ (NPP) wurde in den letzten vier Jahrzehnten ein neues Kapitel der Paulusinterpretation eröffnet. Die Exegeten dieser Richtung sind sich mehr oder weniger darin einig, dass die Paulusauslegung besonders seit der Reformation einseitig individualistisch und das Judentum fälschlicherweise als Gesetzesreligion verstanden wurde. Die Gesetzespolemik des Apostels richte sich weder gegen die Tora noch gegen deren angeblichen jüdischen Missbrauch im Sinne einer Werkgerechtigkeit, sondern gegen die Beschränkung der göttlichen Erwählung auf das Volk Israel. Viele neue Paulusinterpreten stellen der lutherisch-reformatischen Rechtfertigungslehre eine partizipatorische gegenüber. Das Evangelium ist demnach keine Botschaft der Errettung von Sünde und persönlicher Schuld, sondern Verkündigung der Tatsache, dass Gläubige vollberechtigte Mitglieder des göttlichen Bundes sind. Die Rechtfertigungslehre wird entsprechend nicht mehr in der Anthropologie oder Soteriologie, sondern in der Ekklesiologie angesiedelt. N.T. Wright schreibt beispielsweise (What St. Paul Really Said, S. 119):
Mit der „Neue Paulusperspektive“ (NPP) wurde in den letzten vier Jahrzehnten ein neues Kapitel der Paulusinterpretation eröffnet. Die Exegeten dieser Richtung sind sich mehr oder weniger darin einig, dass die Paulusauslegung besonders seit der Reformation einseitig individualistisch und das Judentum fälschlicherweise als Gesetzesreligion verstanden wurde. Die Gesetzespolemik des Apostels richte sich weder gegen die Tora noch gegen deren angeblichen jüdischen Missbrauch im Sinne einer Werkgerechtigkeit, sondern gegen die Beschränkung der göttlichen Erwählung auf das Volk Israel. Viele neue Paulusinterpreten stellen der lutherisch-reformatischen Rechtfertigungslehre eine partizipatorische gegenüber. Das Evangelium ist demnach keine Botschaft der Errettung von Sünde und persönlicher Schuld, sondern Verkündigung der Tatsache, dass Gläubige vollberechtigte Mitglieder des göttlichen Bundes sind. Die Rechtfertigungslehre wird entsprechend nicht mehr in der Anthropologie oder Soteriologie, sondern in der Ekklesiologie angesiedelt. N.T. Wright schreibt beispielsweise (What St. Paul Really Said, S. 119):
Bei „Rechtfertigung“ ging es im ersten Jahrhundert nicht darum, wie jemand eine Beziehung zu Gott aufbauen kann. Es ging um Gottes eschatologische, sowohl zukünftige als auch gegenwärtige Definition davon, wer tatsächlich ein Mitglied seines Volkes ist. Um es mit Sanders’ Worten auszudrücken: Es ging nicht so sehr um das „Hineinkommen“ oder das „Darin-Bleiben“, sondern darum, „wie man sagen kann, wer drin ist“. In der christlich-theologischen Fachsprache ausgedrückt, ging es weniger um Soteriologie als um Ekklesiologie, weniger um Errettung als um die Gemeinde.
Bei der Vielfalt der Meinungen unter dem Dach der NPP verliert man schnell die Übersicht. Ivana Bendik liefert nun mit ihrer 2008 in Basel angenommenen Dissertation Paulus in neuer Sicht? einen forschungsgeschichtlichen Überblick zur NPP. Sie geht den Anfängen dieser Perspektive nach und stellt die Positionen ihrer prominentesten Vertreter zugänglich dar. Damit liegt eine kritische Vermittlung der jüngeren Forschungsgeschichte in deutscher Sprache vor. Hilfreich sind daneben weiterhin die Einführung von Christian Strecker („Paulus aus einer ‚neuen Perspektive‘: Der Paradigmenwechsel in der jüngeren Paulusforschung“, Kirche und Israel 11 (1996), S. 3–17) und der von M. Bachmann im Jahr 2005 herausgegebene Sammelband Lutherische und Neue Paulusperspektive (siehe zudem hier).
Die Untersuchung, die von Prof. Ekkehard W. Stegmann betreut wurde, enthält vier Teile. Zunächst werden die Hauptvertreter der Paulusforschung aus der Zeit von Ferdinand Christian Baur (1792–1860) bis Albert Schweitzer (1875–1965) vorgestellt. Besonderes Augenmerk richtet die Autorin dabei auf den Gedanken des Äonenwechsels. Im zweiten Teil behandelt sie einflussreiche Vertreter der NPP. Sie beginnt mit Rudolf Bultmann (1884–1976), der zwar nicht zur NPP gehört, aber mit seinem existenztheologischen Ansatz die jüngsten Entwicklungen mit vorbereitet hat. Sie bescheinigt ihm einerseits, wie Schweitzer die Eschatologie des Paulus zur Geltung gebracht zu haben. Andererseits wirf sie ihm vor – ebenfalls ähnlich wie Schweitzer –, das antike Judentum übergangen zu haben. Was Schweitzer und Bultmann dem Judentum anlasten, „wirft Paulus der Menschheit generell unter den Bedingungen des schuldbehafteten alten Äons vor“ (S. 18). Weiter beschäftigt sich Bendik mit Johannes Munck (1904–1965), Krister Stendahl ( 1921–2008), Ed Parish Sanders (* 1937) und James D.G. Dunn (* 1939).
Im dritten Teil formuliert die Autorin dann ihre Wertschätzung und Kritik. Die neuen Betrachtungsweisen der NPP unterlaufen die theologischen Interpretationen durch das Aufgebot religionsgeschichtlicher Argumente, die bisherige Schlüsseleinsichten der paulinischen Exegese aufweichen. Die neuen Rahmenbedingungen (Bendik überschreibt diesen Teil ihrer Untersuchung mit einem Zitat von Stendahl: „shift the frame“) erlauben es den Exegeten, das Zentrum der paulinischen Theologie in der universellen Erlösungslehre zu sehen. Sie „verstehen die individualistische Rechtfertigungslehre als ein Nebenprodukt derselben“ (S. 150) und knüpfen wesentlich an der soziologischen Perspektive Muncks an. Anstelle des Sünders rücken die Völker ins Zentrum. Wird in der traditionellen Paulusauslegung der Sünder durch Erlösung ein Gerechtfertigter, „kommen in den Darstellungen der New Perspective die Völker durch Rechtfertigung zu Erlösung, d.h. zu den Rechten an der Heilszusage Gottes an Israel“ (S. 151). Das Gesetz war – wie Sanders erfolgreich gezeigt hat – schon für die Juden nicht dafür gedacht, in den Gnadenbund hineinzukommen, es ermöglicht vielmehr Israel und den Heidenvölkern das Verbleiben im Kreis der Erwählten. Während für Juden wie Heiden der Glaube den Eintritt in den Bund kennzeichnet, ist das Halten des Gesetzes Signum des Bleibens im Bund (vgl. S. 151, 160–161). Sie bemängelt an der NPP, dass ihre Vertreter trotz der Chancen, die sich durch die religionsgeschichtliche Argumentation ergeben, immer wieder in alte Begründungsmuster zurückfallen und einer Antithese von Judentum und Christentum erliegen. Auf der Suche nach geschichtlicher Wahrheit operiere die NPP unkritisch mit übergeschichtlichen Begriffen wie Kirche, Christentum, Religion, Glaube, Identität oder Abgrenzung (vgl. S. 152).
Ihre eigene Paulusdeutung skizziert Ivana Benedikt im letzten Teil des Buches. Sie glaubt, der immer wieder behauptete Paradigmenwechsel habe gar nicht stattgefunden. Nach lautstarker Rehabilitation des Judentums werde nämlich Paulus in der NPP letztlich doch wieder gegen den Judaismus für das Christentum in Anspruch genommen. „Den Vertretern der New Perspective gelingt es … keineswegs, das klassische Paradigma zu verlassen. Die alte Antithese Judentum – Christentum, die sich in der Frage des Gesetzes zuspitzt, geistert in allen vorgestellten Entwürfen weiter herum“ (S. 151). Tatsächlich deute Paulus mit Hilfe der Tora seine Zeit als durch Christi Tod und Auferstehung erwirkte eschatologische Äonenwende. An das Judentum anknüpfend verkündigte der Apostel ein Evangelium, unter dem alle Völker von und vor Gott wieder zusammengeführt würden. Er rief also nicht zum Religionswechsel auf, sondern zeigte, dass durch Christus eine neue Epoche für alle Menschen in Erscheinung getreten ist. Sie schreibt (S. 194–195):
Paulus geht es weder um das individualistische Problem eines gnädigen Gottes noch um ethnische Probleme der Missionsgeschichte. Auch wenn alle diese Aspekte in den Briefen vorzufinden sind, bilden sie nicht das Axiom seiner Theologie. Die Ausgangslage liegt einzig und allein in der apokalyptischen Wende der Gegenwart und des Apostels Bemühen, mithilfe der Tora das zu erklären, was sich schon längst im göttlichen Plan durchgesetzt hat oder sich in Bälde durchsetzen wird. Von Geschehnissen der Äonenwende sind auch die Völker mitbetroffen. Sie sind jedoch nicht die alleinigen Protagonisten des endzeitlichen Dramas. Ihr Schicksal wurzelt in der Dynamik des Handelns Gottes mit Israel und ist von diesem im höchsten Masse abhängig. Der neue Äon trifft die Menschheit an sich und diese besteht aus der Sicht des Paulus aus Israel und den Völkern. Für die eschatologische Stellung eines oder einer Gerechten vor Gott ist jedoch die ethnische Zugehörigkeit bedeutungslos (Gal 6,15; 1 Kor 7,19).
So manches an dieser Einführung bleibt mir rätselhaft. Nur ein kleines Beispiel: Ist es wirklich kontrovers, dass Paulus den Juden das Evangelium verkündigte? (vgl. S. 194). Meiner Meinung nach ist der neutestamentliche Befund diesbezüglich überwältigend eindeutig, sogar dann, wenn ein Exeget Vorbehalte gegenüber der Apostelgeschichte hegt (siehe z.B. Apg 18,4; Röm 1,16; 11,13–15; 1Kor 9,20). Die vorgeschlagene Rechtfertigungslehre kann kaum überzeugen. Bendik lehnt eine Rechtfertigung als Übergangslehre für die Heidenvölker, wie sie von der NPP entwickelt worden ist, zurecht ab. Auch weist sie – was bei ihren Vorbehalten gegenüber der abendländischen Theologie nicht überrascht – eine forensische Rechtfertigungslehre zurück. Sie behauptet dagegen eine effektive Rechtfertigung, in der durch Glauben die sündige Menschheit in unschuldige pneumatische Wesen transformiert werde und der Kampf des Einzelnen mit seinem alten Adam der Vergangenheit angehöre (S. 187–188). Doch die effektive anthropologische Verwandlung, die sie dafür unter Berufung auf 1Kor 15,50 in den Anschlag bringt, ist für den begnadeten Sünder Paulus keine Gegenwartserfahrung, sondern Verheißung, die sich endgültig erfüllt, wenn von Christus errettete Menschen ihren himmlischen Auferstehungsleib empfangen.
Trotz solcher Anfragen lohnt sich die Lektüre des Buches. Eine Beobachtung finde ich übrigens geradezu brillant. Im Blick auf das vornehmlich soziologische Deutungsraster der NPP schreibt Ivana Bendik (S. 152):
Mit der soziologischen Perspektive rückt das Interesse an gruppendynamischen Prozessen in den Vordergrund und verdrängt das Nachdenken über die Zusammenhänge von Sündenmacht – σὰρξ – Gesetz unter den Bedingungen des alten Äons, die einen wichtigen Bestandteil der paulinischen Deutung der Endereignisse ausmachen.
- I. Bendik, Paulus in neuer Sicht?: Eine kritische Einführung in die „New Perspective on Paul“, Stuttgart: Kohlhammer, 2010, Euro 24,00
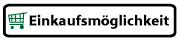
 Der Neutestamentler Douglas Moo (Wheaton College, USA) hat N.T. Wrights neues voluminöses Werk über die Theologie des Paulus:
Der Neutestamentler Douglas Moo (Wheaton College, USA) hat N.T. Wrights neues voluminöses Werk über die Theologie des Paulus: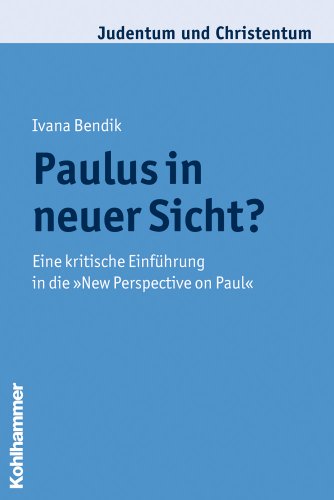 Mit der „Neue Paulusperspektive“ (NPP) wurde in den letzten vier Jahrzehnten ein neues Kapitel der Paulusinterpretation eröffnet. Die Exegeten dieser Richtung sind sich mehr oder weniger darin einig, dass die Paulusauslegung besonders seit der Reformation einseitig individualistisch und das Judentum fälschlicherweise als Gesetzesreligion verstanden wurde. Die Gesetzespolemik des Apostels richte sich weder gegen die Tora noch gegen deren angeblichen jüdischen Missbrauch im Sinne einer Werkgerechtigkeit, sondern gegen die Beschränkung der göttlichen Erwählung auf das Volk Israel. Viele neue Paulusinterpreten stellen der lutherisch-reformatischen Rechtfertigungslehre eine partizipatorische gegenüber. Das Evangelium ist demnach keine Botschaft der Errettung von Sünde und persönlicher Schuld, sondern Verkündigung der Tatsache, dass Gläubige vollberechtigte Mitglieder des göttlichen Bundes sind. Die Rechtfertigungslehre wird entsprechend nicht mehr in der Anthropologie oder Soteriologie, sondern in der Ekklesiologie angesiedelt. N.T. Wright schreibt beispielsweise (What St. Paul Really Said, S. 119):
Mit der „Neue Paulusperspektive“ (NPP) wurde in den letzten vier Jahrzehnten ein neues Kapitel der Paulusinterpretation eröffnet. Die Exegeten dieser Richtung sind sich mehr oder weniger darin einig, dass die Paulusauslegung besonders seit der Reformation einseitig individualistisch und das Judentum fälschlicherweise als Gesetzesreligion verstanden wurde. Die Gesetzespolemik des Apostels richte sich weder gegen die Tora noch gegen deren angeblichen jüdischen Missbrauch im Sinne einer Werkgerechtigkeit, sondern gegen die Beschränkung der göttlichen Erwählung auf das Volk Israel. Viele neue Paulusinterpreten stellen der lutherisch-reformatischen Rechtfertigungslehre eine partizipatorische gegenüber. Das Evangelium ist demnach keine Botschaft der Errettung von Sünde und persönlicher Schuld, sondern Verkündigung der Tatsache, dass Gläubige vollberechtigte Mitglieder des göttlichen Bundes sind. Die Rechtfertigungslehre wird entsprechend nicht mehr in der Anthropologie oder Soteriologie, sondern in der Ekklesiologie angesiedelt. N.T. Wright schreibt beispielsweise (What St. Paul Really Said, S. 119):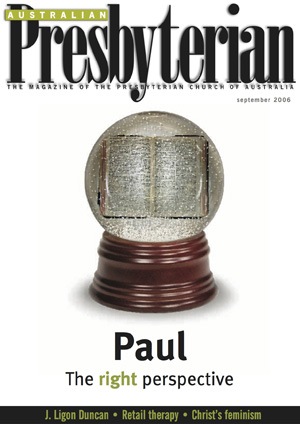 Im Jahr 2005 erschien in der Zeitschrift Australian Presbyterian ein Interview mit Ligon Duncan über die Rechtfertigungslehre. Duncan betont den Aspekt der Anrechnung einer fremden Gerechtigkeit. Wer glaubt, wird nicht durch etwas in ihm oder seine Taten gerechtfertigt, sondern durch die Anrechnung dessen, was Christus für uns getan hat.
Im Jahr 2005 erschien in der Zeitschrift Australian Presbyterian ein Interview mit Ligon Duncan über die Rechtfertigungslehre. Duncan betont den Aspekt der Anrechnung einer fremden Gerechtigkeit. Wer glaubt, wird nicht durch etwas in ihm oder seine Taten gerechtfertigt, sondern durch die Anrechnung dessen, was Christus für uns getan hat.