Karlsruhe hat die letzten Reste eines metaphysischen Schleiers entfernt
Edo Reents hat in der FAZ (06.08.2020, Nr. 181, S. 14) das Sterbehilfeurteil vom Februar 2020 als Konsequenz der Säkularisierung gedeutet.
Wenn das höchste deutsche Gericht Vorsorge dafür trifft, dass jedem Menschen, egal, welchen Alters und in welcher Lage, die Selbsttötung möglich sein muss, zur Not eben mit fremder Hilfe, dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass dieses Urteil einerseits kühn, andererseits aber auch ernüchternd, ja, fast banal, flach wirkt, wie die Bestätigung anderer Selbstbestimmungsrechte auch, zum Beispiel des informationellen oder des sexuellen. Es ist die vielleicht letzte, auf jeden Fall aber gewichtigste Konsequenz, die aus dem Säkularitätsgebot gezogen wurde.
Reents zweifelt daran, dass sich diese von aller Metaphysik bereinigte Rechtssprechung bewährt und macht eine Verlustrechnung auf:
Ein Verfassungssystem, das auch in Gerichtssälen keine Kreuze mehr zulässt, kann sich um einen geistigen Überschuss, ob nun philosophischer oder religiöser Art, nicht mehr kümmern. Diese buchstäbliche Rücksichtslosigkeit, um von der gegenüber Hinterbliebenen oder an der Selbsttötung Beteiligten nicht zu reden, hat etwas (vielleicht ungut) Ernüchterndes. Ungerührt hat Karlsruhe die letzten Reste eines metaphysischen Schleiers entfernt, den die Menschen noch um Fragen des Lebens und des Sterbens gehüllt haben mögen.
Prof. Martin Teising aus Bad Hersfeld geht in seiner Kritik des Urteils noch weiter (FAZ vom 13.08.2020, Nr. 187, S. 25).
Aus der klinischen Forschung wissen wir, dass sich Suizidenten in der Regel verzweifelt und in großer seelischer Not nach Ruhe und Frieden sehnen. Sie wollen so nicht weiterleben. Das Urteil ist von dem Wunsch getragen, diesen Menschen helfen zu wollen, harte Suizidmethoden zu verhindern und ein „sanftes Einschlafen“ zu ermöglichen. Das Gericht blickt nicht der Tatsache ins Auge, dass mit der Selbsttötung, auch durch Medikamente, der Wunsch nach Ruhe und Frieden gerade nicht erfüllt werden kann. Die Empfindung von Ruhe und Frieden setzt Leben voraus.
Das Bundesverfassungsgericht folgt einem Autonomieverständnis, dass die Abhängigkeit von und das Angewiesensein des Einzelnen auf andere Menschen als basale Bedingung menschlicher Existenz verleugnet. Das spricht Reents indirekt an, wenn er die Rücksichtslosigkeit des Urteils gegenüber Hinterbliebenen benennt.
Wenn Bischof Meister von der hannoversche Landeskirche sogar davon spricht, dass der Mensch grundsätzlich ein theologisches Recht auf Selbsttötung habe, lässt dies erahnen, wie fortgeschritten die Selbstsäkularisierung innerhalb der Evangelischen Kirche bereits ist. Die Kirche als Vordenker eines gottlosen Lebens und Sterbens! Zumindest in diesem Sinne wird der missionarische Auftrag noch ernst genommen.
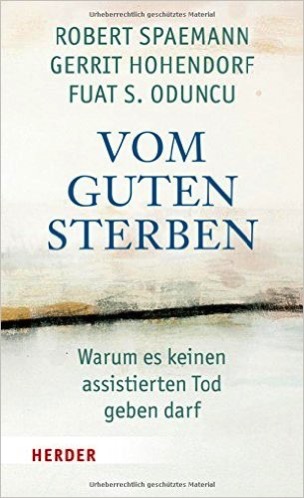 Stephan Sahm schreibt in seiner Rezension:
Stephan Sahm schreibt in seiner Rezension: