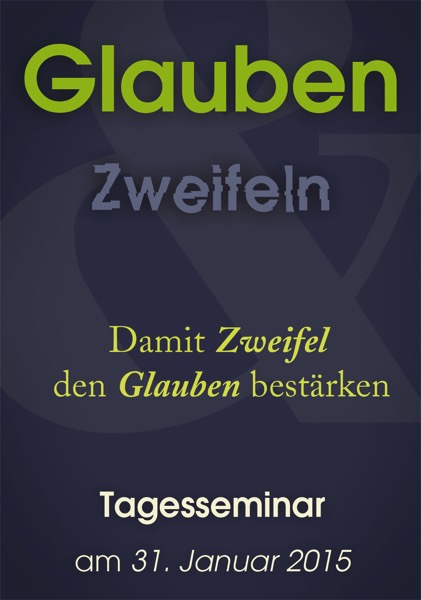„Vergib uns unsere Gewissheit“
Heute gibt es fast keine größere Sünde als die der „Gewissheit“. Wer sich einer Sache sicher ist, erfüllt damit fast schon ein wichtiges Merkmal des Fundamentalismus. Tatsächlich gibt es falsche Gewissheiten und hier und da auch einfach Denkfaulheit. Doch muss ein gewisser Glaube gleich ein arroganter Glaube sein? Es war Martin Luther, der gesagt hat: „Der Heilige Geist ist kein Skeptiker, der nur Zweifel oder bloße Meinungen in unseren Herzen erweckte, sondern er bestätigt gewiss in unserem Gewissen, so dass der Mensch dafür steht und stirbt.“
Mike Ovey schreibt in „Du sollst nicht gewiss sein“:
Natürlich sind Menschen manchmal nicht vertrauenswürdig, sodass Unsicherheit hinsichtlich ihrer Worte und Versprechen durchaus berechtigt ist. Aber der biblische Gott ist jemand, dessen Wort das bewirkt, was er beabsichtigt, und der nicht lügen kann (vgl. Tit 1,2). Das Problem radikaler Ungewissheit besteht darin, dass sie uns davon abhält, Gott zu vertrauen.
Aus geistlicher Perspektive ist dies äußerst gefährlich: Es entehrt Gott und verleitet uns dazu, uns auf uns selbst oder unsere Götzen zu verlassen. Leider ist dies auch äußerst verlockend, denn ich ziehe es vielleicht vor, mich auf mich selbst zu verlassen (mit all der Kontrolle und Selbstbehauptung, die Selbstvertrauen mit sich bringt) anstatt Gott zu vertrauen (mit der Demut und Abhängigkeit, die ein solches Vertrauen mit sich bringt).
Drittens verleitet mich radikale Ungewissheit dazu, an Jesus zu zweifeln: Sie lässt mich daran zweifeln, dass er ein vollkommener Gott ist, der Mensch geworden ist und behauptet, mir Dinge – insbesondere den Namen seines Vaters (vgl. Joh 17,6) – offenbart zu haben. Er hat uns vielleicht nicht alle Dinge im Himmel und auf Erden offenbart, aber er behauptet, offenbart zu haben, wer Gott ist.
Ist es eine Sünde, Gewissheit über Jesus zu haben? Definitiv nicht. Ist es eine Sünde, sich dafür zu entscheiden, hinsichtlich seiner Person, seiner Worte und seines Willens in Ungewissheit zu verharren? Ganz bestimmt. Natürlich kann Gewissheit an sich eine Sünde sein. Aber das gilt auch für vorsätzliche Ungewissheit. Das ist eine ebenso reale und – so fürchte ich – größere Gefahr.
Mehr: www.evangelium21.net.