Der späte Horkheimer und die Familie
Max Horkheimer ist als scharfer Kritiker der Familie in die Geschichte eingegangen. Die Familie erzeuge – so der Sozialphilosoph der Frankfurter Schule – in den Kindern eine autoritative Gesinnung und ist somit Motor für die autoritären Strukturen in der bürgerlichen Gesellschaft.
Nur wenige wissen, dass Horkheimer seine Familienkritik in einer späteren Untersuchung fast umgekehrt hat. Ich zitiere Wolfgang Breiinka aus seinem empfehlenswerten Buch: Die Pädagogik der Neuen Linken (1980, S. 124–125):
In einer späteren Studie (1949) hat Horkheimer sein ursprünglich vorwiegend negatives Urteil über die Familie geradezu umgekehrt und sich zum Anwalt der »Familie im echten Sinn« gemacht, die er als »die verläßlichste und erfolgreichste Gegeninstanz gegen den Rückfall in die Barbarei« bezeichnet. Er schränkt jetzt seine Kritik auf »die Familie in der Krise« ein; er beklagt ihre »Auszehrung« als Folge des »allgemeinen Kulturverfalls«, des Rationalismus und des Individualismus. Gerade weil die Familie weitgehend aufgehört habe, »die ihr eigene Form der Autorität über ihre Mitglieder auszuüben«, fördere sie »einen alles durchdringenden Geist der Anpassung und autoritären Aggressivität«.
Horkheimer nennt als Ursachen dafür den Funktionsverlust der Familie und den Wandel in der Rolle der Mutter. »Die Frauen haben für ihre begrenzte Zulassung zur wirtschaftlichen Welt des Mannes mit der Übernahme der Verhaltensschemata einer durch und durch verdinglichten Gesellschaft gezahlt«. Es mangele ihnen an »ursprünglichem Kontakt mit dem Kind«. »Ihre gesamte Einstellung zum Kind wird rational; selbst die Liebe wird gehandhabt wie ein Bestandteil pädagogischer Hygiene«. Unsere Gesellschaft fördere sogar in jenen Müttern, die nicht berufstätig sind, eine »berufsmäßige«, sachliche Einstellung zum Kind. »Die Mutter hört auf, ein beschwichtigender Mittler zwischen dem Kind und der harten Realität zu sein, sie wird selbst noch deren Sprachrohr«. Dadurch vermittle sie dem Kind nicht mehr das Gefühl der Sicherheit, »das ihm ein gewisses Maß an Unabhängigkeit zu entwickeln ermöglichte«. Weil das Kind heute »nicht mehr die uneingeschränkte Liebe seiner Mutter erfährt, bleibt seine eigene Liebesfähigkeit unentwickelt. Das Kind unterdrückt das Kindliche in sich und verhält sich wie ein berechnender kleiner Erwachsener ohne beständiges, unabhängiges Ich, aber mit einem ungeheuren Maß an Narzißmus. Seine Hartgesottenheit und gleichzeitige Unterwürfigkeit angesichts realer Macht prädisponiert es für die totalitären Formen des Lebens«.
Hier werden also nicht mehr Familie und Autorität schlechthin verketzert, sondern bestimmte Mängel in der Persönlichkeit bestimmter Eltern, die allerdings durch die heute vorherrschenden gesellschaftlichen Lebensumstände mitbedingt sind, als Hauptursachen für die seelische Verwahrlosung von Kindern bezeichnet. Horkheimer betont vor allem den Mangel an Liebe und Zuwendung, an Schutz und »seelischer Obhut« für die Kinder.
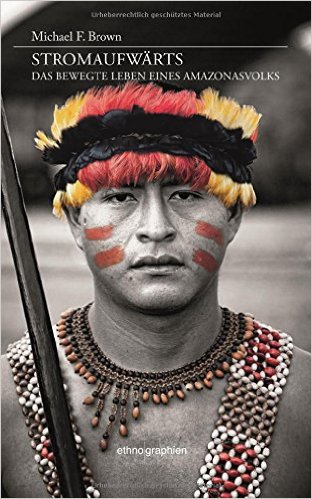
 Biblische Liebe ist nicht nur fader guter Wille oder eine vage Freundlichkeit. Biblische Liebe ist etwas sehr Wirkliches und Realistisches. Gott liebt seine Kinder, die Christus als ihren Retter angenommen haben, so sehr, dass er manchmal Schmerzen durch Züchtigung verursacht. Und wahre biblische Liebe in uns muss auch manchmal zu Schmerz bei Menschen führen, unsere Brüder in Christus mit eingeschlossen. Wenn ein Vater sein Kind züchtigt, tut er es, weil er es liebt. Als Spurgeon zu seiner Zeit seine Stimme erhob, tat er das, weil er sowohl die Lehre über biblische Reinheit als auch die Lehre über biblische Liebe verstand. Wenn wir wahre Liebe zum Herrn, zu den Verlorenen und zu unseren Brüdern in Christus haben, dann werden wir bereit sein, einen großen Preis für persönliche Reinheit und für die Reinheit der Gemeinde zu zahlen. Wenn wir nicht dazu bereit sind, dann fehlt unserer Liebe etwas. Das Ziel muss sein, dass sich unsere Liebe auf praktische Weise so zeigt, dass wir gemeinsam untadelig in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, gegründet sind, – und wie viel mehr ist das wichtig, wenn das Kommen unseres Herrn Jesus Christus so nahe scheint.
Biblische Liebe ist nicht nur fader guter Wille oder eine vage Freundlichkeit. Biblische Liebe ist etwas sehr Wirkliches und Realistisches. Gott liebt seine Kinder, die Christus als ihren Retter angenommen haben, so sehr, dass er manchmal Schmerzen durch Züchtigung verursacht. Und wahre biblische Liebe in uns muss auch manchmal zu Schmerz bei Menschen führen, unsere Brüder in Christus mit eingeschlossen. Wenn ein Vater sein Kind züchtigt, tut er es, weil er es liebt. Als Spurgeon zu seiner Zeit seine Stimme erhob, tat er das, weil er sowohl die Lehre über biblische Reinheit als auch die Lehre über biblische Liebe verstand. Wenn wir wahre Liebe zum Herrn, zu den Verlorenen und zu unseren Brüdern in Christus haben, dann werden wir bereit sein, einen großen Preis für persönliche Reinheit und für die Reinheit der Gemeinde zu zahlen. Wenn wir nicht dazu bereit sind, dann fehlt unserer Liebe etwas. Das Ziel muss sein, dass sich unsere Liebe auf praktische Weise so zeigt, dass wir gemeinsam untadelig in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, gegründet sind, – und wie viel mehr ist das wichtig, wenn das Kommen unseres Herrn Jesus Christus so nahe scheint.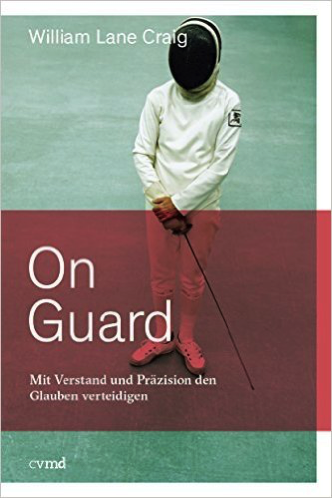 Mit Präzision den Glauben verteidigen
Mit Präzision den Glauben verteidigen Das Magazin
Das Magazin