Wage es nicht, dich genderkritisch zu äußern
Der Berliner Sozialphilosoph Robin Celikates ist Dauergast beim Deutschlandfunk und hat vor einigen Tagen davon gesprochen, dass in Deutschland selbst ernannte „Verteidiger der Wissenschaftsfreiheit ideologische Nebelkerzen werfen und vom vermeintlichen Siegeszug von Political Correctness, Cancel Culture und Identitätspolitik fabulieren“. Kurz: Wer an den Universitäten die Meinungsfreiheit bedroht sieht, „reproduziert ein gefährliches Muster“.
Leider liegt Celikates völlig daneben, wie ich hier im Blog schon oft belegt habe. Über ein jüngstes Beispiel informiert die heutige Ausgabe der FAZ. Die Verteidiger der Diversität haben eine Kampagne gegen die Philosophin Kathleen Stock gestartet, weil sie sich zusammen mit vielen anderen erlaubt zu behaupten, die transaktivistische Vorstellung einer angeborenen nichtbiologischen Geschlechtsidentität sie falsch.
Die FAZ scheint (17.03.2021, Nr. 64, S. N4):
Denn derselbe Robin Celikates hat sich im Januar mit rund 600 anderen Dozenten aus dem In- und Ausland an einer privat orchestrierten Attacke beteiligt, die als „Offener Brief gegen Transphobie in der Philosophie“ euphemisiert war, sich aber einzig gegen eine Wissenschaftlerin richtete: die Britin Kathleen Stock. Die an der University of Sussex lehrende Professorin für analytische Philosophie gehört gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sophie Allen, Mary Leng, Jane Clare Jones, Rebecca Reilly-Cooper und Holly Lawford-Smith zu den Protagonistinnen des genderkritischen Feminismus, der im akademischen Rahmen die Grundüberzeugungen des Gender-Paradigmas revidiert.
Die Denkerinnen widersprechen der transaktivistischen Vorstellung, dass es eine „angeborene Geschlechtsidentität“ gebe, der das biologische Geschlecht ohne medizinischen Befund anzupassen sei. Solche Einwände werden als „transphob“ abgetan, was in manchen Milieus als fast noch niederträchtiger als eine für „rassistisch“ befundene Aussage gilt. Um sich das Stigma der „Transphobie“ einzufangen, reicht es, die gegengeschlechtliche Hormoneinnahme bei Vierzehnjährigen oder die angeblich „inklusiv“ gemeinte misogyne Bezeichnung „Menstruierende“ für Frauen abzulehnen. Wer einmal als „transphob“ gescholten wurde, muss mit Dauerattacken und immensen Reputationsschäden rechnen.
Ein weiterer Absatz zeigt, wie schlimm es um die Wissenschaftsfreiheit bestellt ist:
Unter den Unterzeichnern des verleumderischen Schreibens finden sich nun zahlreiche Namen von Philosophie-Dozenten und -Doktoranden aus Deutschland. Tätig sind sie unter anderem an der FU und HU Berlin, der Ruhr-Universität Bochum, der LMU München, den Universitäten Augsburg, Bielefeld, Erfurt, Hannover, Köln, Konstanz, Leipzig, Münster, Potsdam, Tübingen sowie an der RWTH Aachen. Sie beteiligten sich an einer orchestrierten Aktion gegen eine Einzelne, was zugleich unmissverständlich kommunizierte: Wage es nicht, dich genderkritisch zu äußern, denn damit legst du dich mit Hunderten von uns an, quer durch ebenso viele Institutionen in mehreren Ländern.
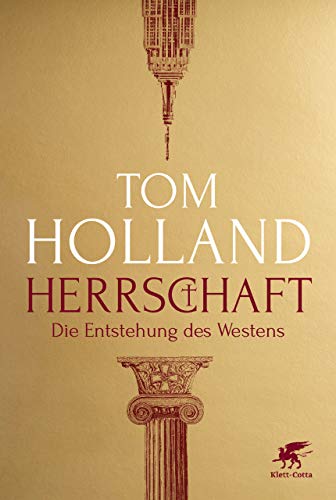 Im April 2020 habe ich auf ein Gespräch verwiesen, welches Nicky Gumbel mit dem Historiker und Schriftsteller Tom Holland über
Im April 2020 habe ich auf ein Gespräch verwiesen, welches Nicky Gumbel mit dem Historiker und Schriftsteller Tom Holland über