 Hier der Auszug einer Buchbesprechung, die vollständig in der nächsten Ausgabe von Glaube und Denken heute erscheinen wird:
Hier der Auszug einer Buchbesprechung, die vollständig in der nächsten Ausgabe von Glaube und Denken heute erscheinen wird:
Ich lese Briefwechsel gern. Meist abends, wenn die Konzentration für anspruchsvolle Lektüre fehlt. Das Studieren der Briefe lässt die Menschen hinter den großen Werken lebendig erscheinen. Die Briefe von Theologen etwa gewähren Einblick in die Entstehenszusammenhänge wichtiger Denkbewegungen. Nehmen wir Karl Barth. Wenn wir an den Schweizer Professor denken, sind wir sofort bei seiner kategorischen Absage an alle „Anknüpfungspunkte“ zum Menschen unter der Sünde. Von einer allgemeinen Gottesoffenbarung oder den Leistungen einer natürlichen Vernunft wollte Barth nicht viel wissen, was schlussendlich zum Zerbruch seiner Freundschaft mit Emil Brunner führte. Barths Briefwechsel mit Eduard Thurneysen ist freilich zu entnehmen, dass Barth noch 1923 mit dieser Frage rang. Er schrieb (Gesamtausgabe, Bd. 4, S. 211):
„… Puncto Vernunft und Offenbarung habe ich bei Peterson, bei dem ich Thomas v. Aquino höre, Erleuchtendes vernommen, was mir das I. Buch von Calvins Institutio erst verständlich macht. Es gibt eine ‚natürliche Theologie‘, sogar die Gottesbeweise sind nicht ganz zu verachten, gerade von der Offenbarung aus muß eine relative und natürlich unvollkommene Erkenntnis Gottes vom Intellekt aus postuliert werden. Aber sag das noch niemand; ich muß erst noch eine Weile darüber schlafen, bis es zur Promulgierung reif wird.“
Ich lese aber nicht nur Briefe von Theologen. Als ich kürzlich erfuhr, dass Martin Heideggers Briefwechsel mit seinen Eltern erschienen ist, hat das sofort mein Interesse geweckt. Heidegger ist zweifellos einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Wer sich mit der Geistesgeschichte Europas beschäftigt, kommt an Heidegger nicht vorbei, auch dann nicht, wenn er ihm – wie beispielsweise Karl Popper – zutiefst misstraut.
Die Heidegger-Gesamtausgabe ist auf 102 Bände angelegt und erscheint seit 1975 im Frankfurter Verlag Vittorio Klostermann. Die Briefe werden von Alfred Denker und Holger Zaborowski im Freiburger Karl Alber Verlag herausgegeben. Geplant sind die Abteilungen „Private Korrespondenz“, „Wissenschaftliche Korrespondenz“ und „Korrespondenz mit Verlagen und Institutionen“. Der Briefwechsel zwischen Heidegger und seinen Eltern sowie seiner Schwester ist als erster Band der Abteilung I erschienen.
Anliegen der Herausgeber ist es, die Briefwechsel von Heidegger in einer Edition zugänglich zu machen, die den Ansprüchen einer wissenschaftlichen Erschließung genügt. Entsprechend wurden sie durch Anmerkungen und Erklärungen ergänzt. Allerdings handelt es sich nicht um eine historisch-kritische Ausgabe, da nicht alle Briefe und Briefentwürfe enthalten sind. Der Anhang enthält neben einem tabellarischen Lebenslauf allerlei Verzeichnisse, darunter auch ein Personenregister. Zudem wurden neun Bilder in den Band aufgenommen. Der Briefwechsel mit Heideggers Eltern beginnt 1907 und endet 1927 und enthält 132 Dokumente. 100 Briefe stammen von Martin Heidegger, 22 von seiner Frau Elfriede und 4 von seiner Mutter. Die restlichen Briefe wurden von Familienangehörigen und Bekannten verfasst.
Die veröffentlichten Dokumente sind für die Forschung bedeutsam, da sie Heideggers einfache Herkunft und seinen Abschied vom Katholizismus belegen. Die Eltern waren schlichte Leute mit einem tiefen katholischen Glauben. Der Vater arbeitete als Fassbindermeister und Mesner in Meßkirch. Er war „ein großer Schweiger“ (S. 198). Die Mutter war lebensfroh und wusste sich auch in schwerer Zeit von Gott getragen. Fritz Heidegger, der Bruder des Philosophen, konnte von ihr sagen, dass sie im Stand der Gnade alles Widerwärtige des Lebens leicht zu ertragen vermochte (S. 198).
Heideggers Verhältnis zu den Eltern war, den Briefen nach zu urteilen, herzlich. Er bedankt sich für Lebensmittelgeschenke und berichtet von seinen Aufgaben als Privatdozent. Zu Spannungen führte, dass Heideggers Gefährtin Elfriede Petri eine Protestantin war und zögerte, dem Wunsch der Schwiegereltern entsprechend zum katholischen Glauben zu konvertieren. Um weiteren Verstimmungen aus dem Weg zu gehen, ließen sich Martin und Elfriede am 21. Februar 1917 unter Ausschluss der Öffentlichkeit katholisch trauen. Zwei Tage später heirateten sie bei den Schwiegereltern in Wiesbaden evangelisch.
…
Am 9. Dezember 1918 schreibt Heidegger einen schmerzbereitenden Brief an seine Eltern. Dies ist der bedeutsamste Brief des Bandes, da er Heideggers Abschied vom Katholizismus dokumentiert. Es kommt eine Zeit, „wo der Mensch selbständig wird“. Heidegger bittet um Verständnis dafür, dass er seine Überzeugungen „im ehrlichen Suchen und Prüfen der Wahrheit“ bildet (S. 35). Er kann nicht mehr mit „innerer Wahrhaftigkeit“ zur katholischen Konfession stehen.
„Ich möchte Euch wiederholt innig bitten, nicht schnell zu urteilen und nun gar darüber verzweifelt zu sein und zu meinen, daß ich überhaupt nichts mehr glaube und so fort. Im Gegenteil, heute, wo ich in selbst errungener Überzeugung ohne die einengenden Schranken und unüberwindlichen Schwierigkeiten des katholischen Glaubens Gott gegenüberstehe, habe ich eine wahrhaft innere Ruhe und Freudigkeit, eine wirklich lebendige Religiosität, während ich früher durch Zweifel und Zwang innerlich zermürbt und leer war und alles nur noch mechanisch, ohne echte innere Beteiligung mitmachen konnte“ (S. 36).
Der Schluss des Briefes kann taktisch oder aufrichtig gedeutet werden:
„Betet bitte täglich für mich, daß ich meinem Wege der inneren Wahrhaftigkeit und der Gottergebenheit treu bleibe und stark sei in den Stürmen der inneren Kämpfe. Und freut Euch mit uns an unserem Glück, das uns alle Gott verbinden soll in gegenseitiger Liebe und in unbedingtem Vertrauen“ (S. 37).
Von da an tritt der Glaube in der Korrespondenz spürbar zurück. Einige Tage später schreibt er anlässlich des Weihnachtsfestes noch: „Ich stehe der katholischen Konfession nicht etwa feindlich gegenüber, im Gegenteil, ich werde mir nie nehmen lassen, was sie an Wertvollem enthält. Ebenso wenig kann ich mich für eine bestimmte protestantische Richtung entscheiden“ (S. 38).
Nicht nur die Mutter, auch die Schwester Maria machte sich Sorgen. Am 31. Mai 1918 erkundigt sie sich bei einem Studienfreund Heideggers nach dessen Glaubensleben:
„Es ist Ihnen vielleicht bekannt, daß meine lieben Eltern nur, auf Vermittlung des Herrn Dr. Krebs, und auf das Versprechen von Elfride, daß sie zur katholischen Kirch übertreten werde, die Einwilligung zur Heirat gaben. Nun bin ich aber anlässlich meines Besuches in Freiburg über das religiöse Leben von Martin und Elfride sehr enttäuscht und erbittert. Besonders grämen sich jetzt meine lieben Eltern furchtbar hierüber“ (S. 161).
Die eilige Antwort muss beruhigend ausgefallen sein. Schon am 4. Juni erklärt Maria, dass sie den Eltern und ihr selbst viel Trost und Freude gebracht habe (S. 162).
Als Martin Heidegger 1921 seiner Schwester zur Hochzeit gratuliert, formuliert er betont fromm, dass Liebe darin bestehe, sich dafür einzusetzen, „dem anderen zu helfen und die Hindernisse aus dem Weg nimmt, vor Gott ein rechter Mensch zu werden“ (S. 113). Seiner Mutter schreibt er aus Köln am 4. Dezember 1924, dass er täglich in der Nachfolge Christi von Thomas von Kempen lese. Die Mutter antwortet beseligt: „Löblich ist es ja, daß Du in der Nachfolge Christi liest, besonders wenn Du danach lebst. Also 3 Ave musst Du beten, wofür Dich Deine Mutter bittet“ (S. 72).
Bewegend ist der Abschiedsbrief, den er seiner schwer leidenden Mutter am 30. April 1927 übersandte: „Du bist mir diesmal zu einem unvergesslichen Vorbild des Mutes und der Ausdauer und des unerschütterlichen Gottvertrauens geworden.“ Weiter heißt es:
„Wenn ich jetzt auch fern von Dir sein muß, so bin ich mit dem Herzen und dem Gedenken um so öfter bei Dir in Deiner mir jetzt vertrauten Krankenstube. Und täglich wünsche und bete ich für Dich, daß diese schweren Tage für Dich nicht allzu hart werden. ‚Bleib brav, dieses Leben ist so bald vorbei‘ hast Du mir beim Abschied gesagt. Mutterworte bleiben unvergessen. ‚Und es war doch ein schönes Leben, Mutter‘ erwiderte ich Dir. Und da sagtest Du aus innerster Seele und mit einem freudig dankbaren Blick ‚ja, Martin, es war schön‘. Dieses Gespräch bewahre ich in meinem Herzen, und wenn immer ich Deiner gedenke, soll es mir Dein immer frisches Bild verklären“ (S. 108).
Am 3. Mai ist Johanna Heidegger gestorben.
Auch wenn in den Briefen viel Belangloses zu lesen ist, hat sich die Lektüre gelohnt. Die Gottesfrage hat Heidegger trotz seiner Absage an den Katholizismus und den jüdisch-christlichen Gott nie losgelassen. „Ohne … theologische Herkunft wäre ich nie auf den Weg des Denkens gelangt“, bekannte er 1953. Und schon 1948 hatte er gesagt: „Meine Philosophie ist ein Warten auf Gott“ (vgl. „Warten auf Gott“, Der Spiegel, Nr. 20/1972, S. 146–149).
Aus einem Brief Barths ist übrigens zu entnehmen, dass dieser in Marburg mit Heidegger zusammentraf. „Der Philosoph Heidegger“ – schreibt der Theologe – war „sehr zustimmend, es sei methodisch alles in Ordnung gewesen, keine Grenze überschritten, aber mit der Frage nach unserem Verhältnis zu Kant, den er zu Aristoteles rechne, von dem sich der junge Luther losgesagt habe“ (Gesamtausgabe, Bd. 4, S, 229).
Schade, dass Briefe heute eine Rarität sind. Sie werden zukünftigen Generationen fehlen.
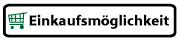
 Hier der Auszug einer Buchbesprechung, die vollständig in der nächsten Ausgabe von Glaube und Denken heute erscheinen wird:
Hier der Auszug einer Buchbesprechung, die vollständig in der nächsten Ausgabe von Glaube und Denken heute erscheinen wird: