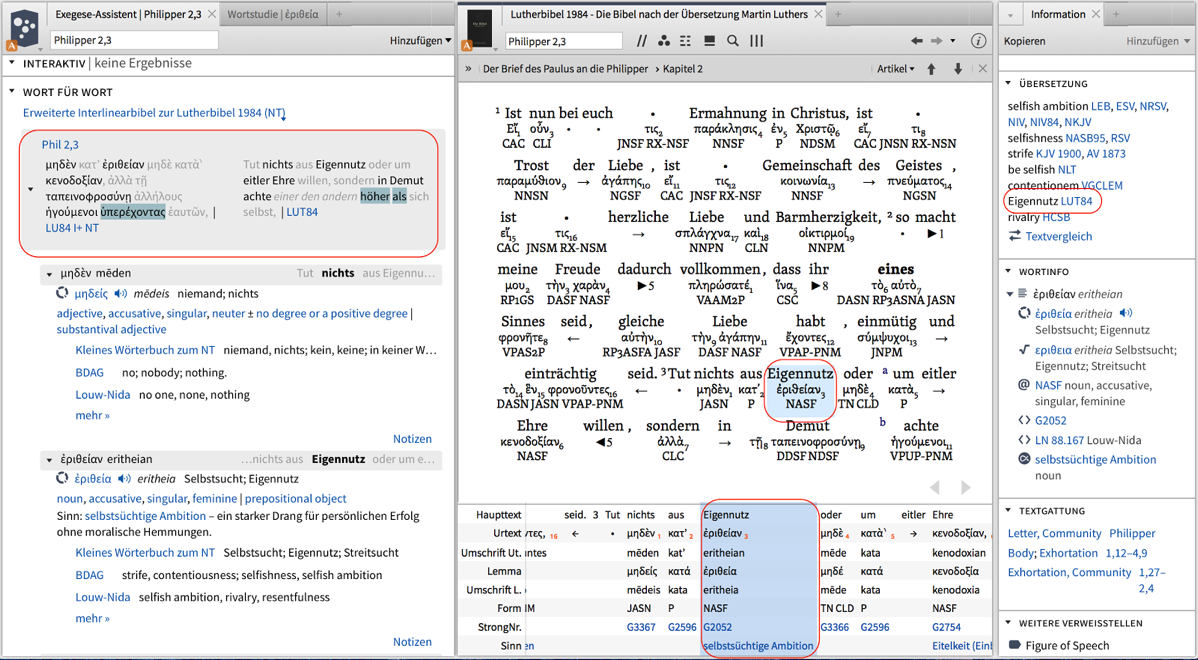Neue Wege in der Liebe: Die Nashville-Erklärung
Vor zwei Tagen habe ich mir die TV-Sendung „Neue Wege in der Liebe: Moderne und traditionelle Beziehungsmodelle“ angesehen. Die Sexologin und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning stellt dort heraus, dass die „Verhandlungsmoral“ die alte „Verbotsmoral“ längst abgelöst hat und alles möglich ist, was jemand begehrt (siehe dazu auch: Die Postmoderne, 2007, S. 53–57). Da ist etwa Sylvia, die sich als geborene Polyamore bezeichnet und jetzt, da sie gleichzeitig mehrere Menschen beiderlei Geschlechts liebt, endlich glücklich ist. Oder da sind Uli und Martin, die ihre Beziehung als offen bezeichnen und in ein Liebesnetzwerk eingebettet sind. Entscheidend ist, was ich fühle, die Lust. Letztes Tabu ist der Zwang. Das verbreitetste Modell – so Ann-Marlene Henning – sei es, in einer Hauptbeziehung zu leben und gleichzeitig mehrere Nebenbeziehungen zu haben. Dabei läuft alles transparent. Zur Offenheit gehört das Gespräch über mein Netzwerk und den letzten Höhepunkt. Die Beziehungszeiten werden übrigens immer kürzer. Das Singledasein ist – vielleicht eine logische Konsequenz – ein wachsendes Format. Bei allem gesetzgeberischen Einsatz für die Ehe, den wir in den letzten Monaten erlebt haben, finde ich – nebenbei – interessant, dass die polyamoren Netzwerke und das Singledasein so im Trend liegen.

Machen wir uns nichts vor. Die Sexualethik ist seit Jahren ein wichtiger Prüfstein für die Bekenntnisfestigkeit der christlichen Kirchen. Der Druck von außen und innen wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Vor allem die junge Generation wird über die Kultur und die Schule beflügelt, neue Beziehungsmodelle attraktiv zu finden und sie auch mal auszutesten.
Um so wichtiger ist es, dass Pastoren, Gemeindeleiter und Jugendleiter (!) Farbe bekennen. Keine Meinung zu haben, sich aus dem Prozedere einfach schick herauszuhalten, ist, seien wir ehrlich: billige Anpassung.
Mehr als 150 evangelikale Leiter aus den USA haben nun eine theologische Stellungnahme zur Sexualethik veröffentlicht, das so genannte Nashville-Statement. Zu den ersten Unterzeichnern gehören Theologen wie J.I. Packer, Wayne Grudem, Mark Dever, Heath Lambert, Vaughan Roberts, John Frame, Kevin DeYoung, Thomas Schreiner oder Michael Reeves. Auch der Philosoph J.P. Moreland oder die Literaturwissenschaftlerin Rosaria Butterfield haben die Erklärung unterschrieben (an dieser Stelle kann gezeichnet werden).
Die Nashville-Erklärung kann hier heruntergeladen werden: The-Nashville-Statement-and-Initial-Signatories-List.pdf.