 Tanja Bittner ist in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Glauben und Denken heute Thorsten Dietz’ Buch über Sünde besprochen. Ich darf die Rezension hier wiedergeben:
Tanja Bittner ist in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Glauben und Denken heute Thorsten Dietz’ Buch über Sünde besprochen. Ich darf die Rezension hier wiedergeben:
- Thorsten Dietz. Sünde: Was Menschen heute von Gott trennt. Witten: SCM R. Brockhaus, 20172 (Erstauflage 2016). 220 Seiten. 16,95 Euro.
„Das Wort Sünde funktioniert nicht mehr. Statt irgendetwas zu erklären, bedarf dieser Ausdruck selbst der ständigen Erläuterung. Er produziert nur noch Missverständnisse“ (S. 5). Diese Feststellung bildet den Ausgangspunkt für eine „Entdeckungsreise“ (S. 22), zu der der Autor Christen und Nichtchristen einlädt, um der Sünde von neuem auf die Spur zu kommen. Die Stationen dieser Reise werden im Folgenden zunächst nachgezeichnet:
Der Begriff ist für den christlichen Glauben zentral. Aber er ist auch in problematischer Weise moralisierend geprägt worden, so dass er für viele Menschen heute unverständlich, sinnlos, ärgerlich ist. Menschen wurden damit abgewertet, entmündigt; anmaßende Verkündiger haben ihn gebraucht, um mit dem Finger auf andere zu zeigen und einige ausgewählte Sünden anzuprangern. „Ein neuer Anfang ist nötig. […] Will man am Christentum festhalten, dann kann es um nicht weniger als darum gehen, den christlichen Glauben neu zu entdecken, zu befreien aus so mancher problematischen Verstrickung oder Verengung“ (S. 21f).
Traditionelle Perspektiven auf die Sünde (Schuld, Misstrauen, Maßlosigkeit, Verführung, Zielverfehlung) haben ihre Berechtigung, greifen aber für den heutigen Menschen nur noch begrenzt. Schuld hat in unserer multireligiösen Gesellschaft ihre Verknüpfung mit den Zehn Geboten verloren, diese Funktion übernehmen mehr und mehr die Menschenrechte. Zumal es in unserer kompliziert gewordenen Zeit ohnehin nicht mehr so einfach ist, zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden. Misstrauen bedeutet Verkehrung des Vertrauens. In seiner Verletzlichkeit benötigt der Mensch einen sicheren Halt, das Vertrauen auf Gott, statt sich auf andere Dinge zu verlassen, die ihn nicht tragen. Doch begünstigt dies eben auch ein Schwarz-Weiß-Denken und diskreditiert Nichtchristen als moralisch unterlegen. Betrachtet man Sünde als Maßlosigkeit, so geht es um das Begehren, das sich auf die falschen Dinge ausrichtet, statt die Erfüllung in Gott zu suchen – um das Habenwollen, statt liebend zu geben. Leider wurde bei diesem Blickwinkel oft vor allem das Verbotene betont. Dagegen wurde Sünde als Verführung häufig nicht genügend beachtet. Der Mensch ist auch Opfer der Sünde (wenn wir auch die Sündenfallserzählung nicht „mit Erklärungsansprüchen“ „überfrachten“ sollten [S. 43]). Sünde als Zielverfehlung fand ebenfalls eher zu wenig Beachtung. Viele Handlungen können in der einen Situation richtig, in der anderen falsch sein. Nimmt man ein Menschenleben als Ganzes in den Blick, bedeutet diese Zielverfehlung, dass jemand hinter dem, was eigentlich seine Bestimmung gewesen wäre, zurückgeblieben ist.
So wendet sich Dietz nun der Aufgabe zu, den ursprünglichen Gedanken der Bibel zum Thema wieder auf die Spur zu kommen. Er will aber auch entdecken, was die Narrative unserer Zeit (wie sie auf den Kinoleinwänden erzählt werden) dazu beitragen können, in denen sich das Leben, Fürchten und Träumen der heutigen Menschen widerspiegelt und verdichtet. Beide Perspektiven seien wichtig, um die jeweils andere zu verdeutlichen. Unter den Stichworten Blind, Hart, Süchtig, Selbstlos, Reich, Sicher und Träge werden nun sieben „neue“ bzw. „neu verstandene“ (S. 7) Sünden entfaltet.
Blind meint die Blindheit für sich selbst, die eigene Situation. Biblische Bezugspunkte findet der Autor im von Jesus kritisierten Pharisäertum. Man lebt in einer Selbsttäuschung, die die eigene Wahrnehmung für die Wirklichkeit hält (siehe auch die Matrix-Trilogie), was sich beispielsweise in Vorurteilen und Selbstgerechtigkeit manifestiert. Der Augenöffner für den Blinden ist die Erfahrung der Liebe, die Erfahrung von Schönheit, kumuliert in der Begegnung mit Gott. Da wir in einer von der Verblendung durchdrungenen Welt leben, sollten wir uns des Wahrheitsgehalts unserer persönlichen Sicht nicht allzu sicher zu sein.
Hart weist auf das harte Herz, das nach biblischem Zeugnis durch ein fleischernes Herz ersetzt werden muss (vgl. Hes 36,26). Weder verhärtet sich der Mensch nur aktiv selbst, noch wird er nur passiv verhärtet (vgl. der Pharao in Ex 7–14). Wir sind verstrickt in das Zusammenwirken von Schuld und Schicksal (siehe die Person des Darth Vader in Star Wars). Von der Bibel sollten wir keine einfachen Antworten auf die Frage nach dem Ursprung des Bösen erwarten, da sie hier „geheimnisvoller, offener, andeutender“ (S. 83) redet als wir das vielleicht gern hätten. „Echter Glaube will nicht alles begreifen und in ein System pressen können“ (S. 83). Mit Dorothee Sölle verbindet er das Phänomen der Härte mit dem Begriff der Entfremdung, nämlich von sich selbst und von anderen. Der Gegenpol ist wieder die Liebe (vgl. 1Kor 13), die der Verhärtung widersteht und sich verletzlich macht.
Süchtig verdeutlicht ebenfalls, wie Täter- und Opfersein des Menschen ineinander fließen. Im Sog der Sucht verliert der Mensch die Kontrolle an eine Macht, die ihn beherrscht (vgl. auch Röm 7,14–20), indem sie ihm ein Stückchen Glück verheißt und schließlich das Leben völlig vereinnahmt (siehe Gollum in Herr der Ringe). Die Lösung heißt Freiheit, doch der Mensch findet diese nach Bonhoeffer gerade nicht in der Niederwerfung aller Grenzen, sondern in der Bindung an den Schöpfer. Der praktische Weg in die Freiheit beginnt mit dem Eingeständnis der eigenen Ohnmacht, benötigt eine sich gegenseitig stützende Gemeinschaft, und beendet schließlich die Opferrolle, indem die Verantwortung für das eigene Leben übernommen wird (vgl. das Konzept der Anonymen Alkoholiker).
Selbstlos zu sein ist nach Dietz nur scheinbar das positive Gegenteil von einer negativ zu bewertenden Selbstbezogenheit. Die Dinge sind nicht so einfach, wie sie zunächst aussehen. Wenn Jesus in Mk 8,34–37 dazu aufruft, sich selbst zu verleugnen und ihm nachzufolgen, geht es zentral um die Frage: „Wie gewinne ich mein wahres Selbst?“ (S. 116). Anhand verschiedener Figuren aus Harry Potter wird deutlich: Wer wir wirklich sind, zeigt sich daran, wie wir mit den herausfordernden Situationen des Lebens umgehen. Nach Kierkegaard ist die Aufgabe jedes Menschen, er selbst zu werden, während er die Gegebenheiten, in die Gott ihn stellt, vertrauensvoll akzeptiert (statt sich daran abzumühen, nicht er selbst bzw. jemand anderes sein zu wollen).
Dietz’ Zwischenbilanz nach diesen ersten vier, eher persönlich zugespitzten Sünden lautet: „Wir verfehlen unsere Bestimmung in der Verdrängung der Wahrheit, unserer Abkehr von der Liebe, in der Flucht vor der Freiheit und in der Verweigerung des Vertrauens. So verfehlen wir Gott, indem wir uns selbst verfehlen. Und so werden wir unserer Berufung nicht gerecht, indem wir an Gott vorbei leben“ (S. 131). Es folgen drei strukturelle Sünden:
Reich: Dietz warnt davor, vorschnell nur den Missbrauch des Reichtums (wie Geiz, Habgier) zu problematisieren und sich dann entspannt zurückzulehnen. Die Bibel kann sehr pauschal sein, wenn sie auf Reichtum zu sprechen kommt (z. B. Jak 5,1; Lk 6,24–25). „Reichtum ist nicht neutral. Nein, Reichtum allein verdirbt nicht den Charakter, aber er steigert die Chancen, dass dies geschieht“ (S. 138; siehe die Serie Breaking Bad). Dagegen ruft Papst Franziskus im Hinblick auf das Flüchtlingselend dazu auf, unsere Gleichgültigkeit abzulegen, hinzusehen und hinzuhören, mitzuleiden und mitzuweinen.
Sicher: Unser Sicherheitsbedürfnis verleitet uns dazu, die Welt zu vereinfachen und Freund-Feind-Schemata aufzubauen. Doch Jesus überwindet in der Bergpredigt diese sicheren Bahnen (Mt 5,43–48), ruft zu Gewaltverzicht auf und macht selbst den Feind zu meinem Nächsten, den ich lieben soll (siehe auch die Hobbits Frodo und Sam in Herr der Ringe). Natürlich ist Fundamentalismus mit seiner „schlichten Logik des Entweder-Oder, Schwarz oder Weiß“, mit seiner „Wut, seine[r] Ausgrenzungsbereitschaft und Unversöhnlichkeit“ (S. 167) abzulehnen. Das Vorhandensein klarer Überzeugungen ist aber nicht prinzipiell als fundamentalistisch anzusehen. Entscheidend ist das Moment der „aggressiven Abwertung“ (S. 168), die Verweigerung der echten Auseinandersetzung mit anderen Sichtweisen und die Unfähigkeit, diese stehen zu lassen. Entsprechend muss sich der Nichtfundamentalist für die Diskussion mit dem Fundamentalismus eine Offenheit bewahren, die eben diese Fallstricke vermeidet.
Träge: Pontius Pilatus ließ sich wider besseres Wissen letztendlich darauf ein, den Unschuldigen zu opfern, ging den Weg des geringeren Widerstands – wohl aus Angst vor den Folgen. Ähnliches wird auch in Tribute von Panem thematisiert, wo sich der Kampf gegen Mitläufertum und Anpassung als zunehmend unübersichtlich erweist. Dabei spielt auch Verantwortungsbewusstsein (z. B. für die Familie) eine Rolle. Karl Barth weist darauf hin, dass Sünde nach zwei Richtungen hin möglich ist, nämlich einerseits die Überhöhung des Menschen (Hochmut) und andererseits die Weigerung, sich auf die eigene Berufung einzulassen (Mutlosigkeit, Rückzug). „Das Leben wird auch da verfehlt, wo Menschen ihre eigenen Möglichkeiten nicht entdecken, ihre Gaben nicht entfalten und einsetzen“ (S. 190).
Im Schlusskapitel setzt Dietz nun diese Sünden in Beziehung zu Jesus. Im Hinblick auf die Blindheit war Jesus der, unter dessen Blick Menschen „wagten, das Wunder zu glauben, dass Gott sie mit liebenden Augen ansah“ (S. 195) und er öffnete auch ihren Blick füreinander. Er lebte berührbar und verletzlich. In seiner völligen Abhängigkeit von Gott war Jesus unabhängig von jeder irdischen Vereinnahmung. Gerade in seiner gelebten, selbstlosen Liebe war er ganz er selbst. Jesus lebte in Armut, doch ohne Berührungsängste gegenüber Reichen, und tatsächlich „hieß es von ihm, dass er durch seine Armut viele reich machte“ (siehe 2Kor 8,9; S. 196). Jesus lebte mit der Bedrohung seiner persönlichen Sicherheit, doch er ließ sich nicht von der Angst beherrschen. Und er ließ sich nicht auf die Spiele der Menschen ein, sondern folgte stets seiner eigenen, nicht berechenbaren Agenda.
Die Bibel nennt Jesus sündlos. In den Helden der Kinoleinwand finden wir dieses Muster wieder: es gibt Widerstände aller Art, aber der Eine geht geradlinig seinen Weg und kann am Ende die Welt retten. Auch wenn im Hinblick auf die Evangelien viel Unsicherheit bestehen mag, was und wieviel davon tatsächlich so passiert ist, kann uns Jesu Leben Hoffnung geben. Zwar endet sein „Gottesexperiment“ (S. 204) in einer Katastrophe, mit seinem Tod scheint alles aus zu sein. Und doch war das der Anfang einer Bewegung von Jesusnachfolgern. Gott kam auf seine Weise zum Ziel. Das gibt uns die Perspektive, uns auf ein solch radikal anderes Leben einzulassen, das geprägt ist von Vergebung, Versöhnung und der Hoffnung, dass irgendwo da draußen ein Happy End warten könnte, für das es sich zu kämpfen lohnt.
Thorsten Dietz hat sich mit diesem Buch aufgemacht, heutigen Menschen einen neuen Zugang zu einem Kernthema des christlichen Glaubens zu eröffnen. Er analysiert richtig, dass dieser Zugang heute weitgehend verschüttet und deshalb das Christentum davon bedroht ist, in der Irrelevanz zu versinken. Menschen ohne Bewusstsein für Sünde sind an Erlösung wohl wenig interessiert. Er hat sich also eine wichtige Aufgabe gestellt. Das Buch ist allgemeinverständlich geschrieben und es gelingt ihm, dem Leser unaufdringlich den Spiegel vorzuhalten. Was er schreibt, hat mit meinem Leben zu tun und fordert heraus, sich in den diskutierten Bereichen selbst zu reflektieren. Doch insgesamt greift das Buch zu kurz, vermittelt nur eine flache Sicht auf das Thema.
Das liegt wohl bereits am Vorgehen an sich – nämlich dem Versuch, im Dialog von Bibel und aktuellen Narrativen zu einer zeitgemäßen Sicht auf die Sünde zu kommen. Die Bibel wird als eine Art uralter, christlicher Basis-Narrativ neben die neuen Narrative gelegt und das Ganze auf Gleichklänge untersucht. Das Ergebnis ist vorprogrammiert: man findet das in der Bibel wieder, was unsere Kultur als Sünde definiert. Aber auch nichts anderes. Die großen Werte im Untergrund heißen Toleranz, Relativismus, Selbstwerdung – Sünde ist, wenn diese Werte verletzt werden. Was keinen Widerhall findet in unserer Zeit, fällt unter den Tisch. Das gilt nicht nur für Sünden, die heute nicht mehr als Sünde gelten (z. B. Ehebruch), sondern es fehlt beispielsweise auch der Gott, der uns zur Verantwortung ziehen wird, und das nicht nur, weil wir unsere eigentliche Bestimmung verfehlen, sondern weil Sünde auch Rebellion gegen ihn bedeutet (vgl. Kol 3,5–7; Paulus nennt Sünder „Feinde“ Gottes, „Gotteshasser“: Röm 5,10; 1,30).
Entsprechend erscheint auch die (Er-)Lösung blass. Jesus ist das Vorbild, das irgendwie alles richtig gemacht hat. Uns bleibt der Versuch, Werte wie Liebe, Mut, Verantwortung und Hoffnung im Vertrauen auf Gottes Hilfe umzusetzen, während wir unsere Sündenverstrickung gleichzeitig als unausweichliches Schicksal annehmen müssen.
Es fehlt Wesentliches. Ohne den biblischen Sinnzusammenhang, in den Sünde und Erlösung eingebunden sind, bleibt nur ein kraftloser (moralisierender?) Schatten der biblischen Botschaft übrig. Nicht im Blick ist der Gott, mit dessen Heiligkeit Sünde unvereinbar ist und der uns gerecht richten wird, also verurteilen muss (Apg 17,31; Röm 3,10). Nur äußerst diffus ist zu ahnen, was die Bibel deutlich sagt, nämlich, dass Jesus am Kreuz die Vergebung der Sünden erworben hat, dass für den, der an ihn glaubt, der Schuldschein tatsächlich abgetan ist (Kol 1,21f; 2,14; 1Joh 2,2). Erst auf den vorletzten Seiten (S. 207f) taucht dazu wie ein Fremdkörper ein einsames Zitat aus 2Kor 5,17–21 auf, ohne weiteren Kommentar. So hat Dietz denn auch ganz am Ende nur ein irrationales Man sollte die Hoffnung nicht aufgeben! anzubieten, präsentiert von Sam aus Herr der Ringe.
Es ist fraglich, ob nicht gerade diese Strategie das Christentum in die Irrelevanz führt – eine Kirche, die der Welt nur das sagt, was diese bereits glaubt, ist überflüssig. Aber was soll auch anderes zu sagen übrig bleiben, wenn die Bibel zu einem alten Narrativ mit nicht näher bestimmbarem Wahrheitsgehalt geworden ist? „Es ist weder nötig noch plausibel zu behaupten, alles hat sich buchstäblich so zugetragen oder ist wortwörtlich von den Beteiligten so gesagt worden“ (S. 201, hier bezogen auf die Evangelien). „Wer diese Texte nicht symbolisch liest, der verfehlt ihren Sinn“ (S. 105, über den Sündenfall). Wenn die Bibel nicht die Wahrheit ist, dann hat sie uns tatsächlich nicht mehr zu sagen als Star Wars oder Harry Potter. Man kann Impulse mitnehmen – mehr aber auch nicht.
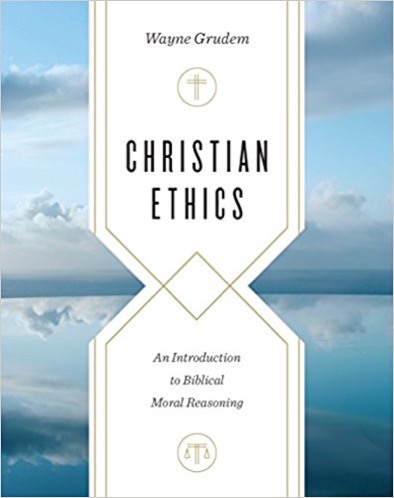 Wayne Grudem, Autor der auch in Deutschland bekannten Systematischen Theologie, hat nun seine Christliche Ethik vorgelegt.
Wayne Grudem, Autor der auch in Deutschland bekannten Systematischen Theologie, hat nun seine Christliche Ethik vorgelegt. In seinem neuesten Buch
In seinem neuesten Buch  Tanja Bittner ist in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Glauben und Denken heute Thorsten Dietz’ Buch über Sünde besprochen. Ich darf die Rezension hier wiedergeben:
Tanja Bittner ist in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Glauben und Denken heute Thorsten Dietz’ Buch über Sünde besprochen. Ich darf die Rezension hier wiedergeben: