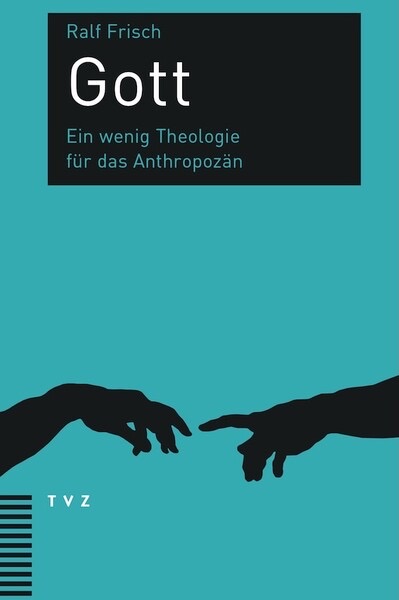Andrew Lowenthal: „Deutschland hat Zensurkomplex“
Es ist ein beunruhigender Befund: Der Australier Andrew Lowenthal hat in den USA ein Netzwerk aus NGOs, Geheimdiensten, Regierungsstellen und Tech-Plattformen erforscht, das seiner Meinung nach die öffentliche Debatte mitsteuert. Nun hat er sich die Lage in Deutschland angeschaut und kommt zu dem Ergebnis, dass die Situation hier nicht besser ist. Hier gibt es einen Zensur-Industrie-Komplex aus NGOs, Universitätszentren, Faktencheck-Programmen, Thinktanks, Stiftungen und Regierungsabteilungen, die gemeinsam Online-Inhalte entfernen – in der Regel unter dem Vorwand, gegen „Desinformation“ oder „Hassrede“ vorzugehen.
Zitat:
Ein besonders drastisches Beispiel ist das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, das nach unseren Daten der größte staatliche Geldgeber für Anti-Hassrede- und Anti-Desinformations-Projekte ist und de facto zu den größten staatlichen Finanzierungsmaschinen für Inhalts- und Narrativkontrolle gehört. Das Programm, betrieben vom Bundesfamilienministerium, bewegt jährlich nahezu 200 Millionen Euro und verteilt diese Mittel auf Dutzende Organisationen und über 170 Projekte. Viele davon arbeiten direkt an der Regulierung vermeintlicher Desinformation, Hassrede oder anderer politisch definierter Ausdrucksformen. Ein illustrativer Fall ist HateAid: Die Organisation hat über die Jahre fortlaufende staatliche Förderung erhalten – insgesamt mehr als 2,39 Millionen Euro aus Mitteln des Familienministeriums und des Justizministeriums – und fungiert zugleich als „Trusted Flagger“ im Sinne des „Digital Services Act“ der EU, mit der Befugnis, Inhalte zur beschleunigten Prüfung zu markieren, was in der Praxis häufig zu schnellen Löschungen führt. Durch diese Förderstrukturen entsteht ein staatlich finanziertes Netzwerk, das nicht nur klassische Bildungsarbeit leistet, sondern direkt in die Bewertung, Einstufung und Eskalation von Online-Äußerungen eingreift.
Und noch ein Zitat:
In Deutschland gelten bestimmte Positionen nicht als politische Haltungen, sondern als bürgerliche Pflicht. So werden Debatten verengt. Maßnahmen werden als ethisch notwendig dargestellt – nicht als politische Entscheidung. Doch was als unzulässige Rede gilt, ist immer selbst politisch.
Ich befürchte, dass die Debatte, die durch solch einen Befund angeleiert werden müssten, zumindest im ÖRR nicht stattfinden wird.
Mehr (hinter einer Bezahlschranke): www.welt.de.