Ralf Frisch: Gott
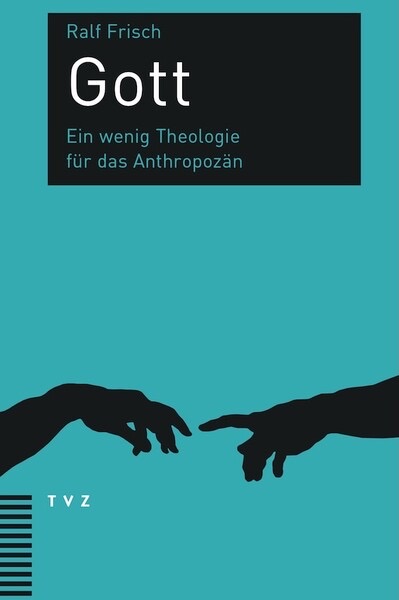
In seinem neuen Buch Gott kritisiert Ralf Frisch die anthropozentrische Theologie unserer Zeit. Genauso wenig, wie Bäckereien überleben werden, wenn sie Hungrigen Steine statt Brot verkaufen, wird eine Kirche bestehen können, wenn der Mensch die Antwort auf alle Fragen ist.
Hier aus meiner Rezension:
Aber wer ist dieser Gott, von dem die Kirche zu reden hat? Frisch verteidigt das „Deus semper maior“. Gott ist immer größer, als Menschen glauben und denken. Er übersteigt alle menschlichen Versuche, ihn mit der Vernunft zu fassen (vgl. S. 62). „Der Mensch ist Mensch. Und Gott ist Gott … Gott kann nicht das Wesen sein, dem die Welt überlegen sein könnte. Sonst wäre er nicht Gott“ (S. 63). Doch auch wenn sich Gott den positiven Definitionen entziehe, könne ausgeführt werden, was Gott nicht ist. Gott sei kein vergöttlichter Mensch und keine Chiffre für humanitäre Solidarität (vgl. S. 64 f.). Gott könne laut Frisch auch keine unpersönliche Macht, sondern müsse ein personales Wesen sein. Denn ein „Gott, der keine Person ist, verdient den Namen Gott nicht. Ein Gott, der nur irgendwie da wäre, aber nicht wissen und fühlen würde, wie es ist, ‚da‘ zu sein, wäre kein Gott“ (S. 71).
Es ärgert Frisch, dass die akademische Theologie verlernt hat, über Gott zu staunen. Sie duldet nicht, dass Gott die menschlichen Rationalisierungen aufbricht und „in den intellektuell, psychisch und moralisch abgeriegelten Raum der Welt eindringt“ (S. 85). „Dass Gott in irgendeiner Weise zu fürchten und ihm nicht mit Hochmut, sondern mit Demut zu begegnen sein könnte, ist eine Vorstellung, die von der humanistischen Theologie unserer Gegenwart nahezu rückstandslos entsorgt wird“ (S. 93).
„Eine erschreckend weltfremde Identifizierung von Gott und Natur und von Gottvertrauen und Naturvertrauen im Namen einer naturverklärenden Schöpfungsspiritualität inklusive der theologisch im Blick auf den HERRN längst verabschiedeten Demuts- und Ehrfurchtrhetorik greift immer unverhohlener und immer unwidersprochener um sich.“ (S. 98)
„Von Gottesfurcht und Gottesschrecken, die in der Bibel mit jeder Epiphanie einhergehen, ist vielleicht tatsächlich nur noch die Angst der aufgeklärten Christinnen und Christen übriggeblieben, Gott zum Thema zu machen“ (S. 85 f.). Unter Berufung auf Rudolf Otto und Ludwig Wittgenstein plädiert Frisch dafür, das Unaussprechliche dadurch zu ehren, dass man anbetend schweigt (vgl. S. 88): „Vielleicht herrscht im Protestantismus zu viel Ethos und zu wenig Sprachlosigkeit, also zu wenig Kultus und zu wenig Mystik“ (S. 87).
Mehr: www.evangelium21.net.
