Die schrecklichen Ereignisse in Norwegen machen uns zu schaffen. Allein sich vorzustellen, was die Opfer während der Attentate durchgemacht haben, kann den Schlaf rauben. Den Betroffenen und Hinterbliebenen gilt mein tiefes Mitgefühl. Mögen sie in diesen schweren Tagen Trost finden und neue Kraft schöpfen.
Während der Berichterstattungen über die Anschläge in Oslo wurde viel über die Motive des mutmaßlichen Attentäters spekuliert. Dass Anders Breivik in ersten polizeilichen Stellungnahmen als »christlicher Fundamentalist« charakterisiert wurde, erwies sich als unglücklich. Die Ermittlungen zeigten schnell, dass diese Einschätzung im Kern falsch war. Das hasserfüllte Weltbild dieses Mannes hat mit dem christlichen Glauben wenig zu tun (aufschlussreich dazu der Artikel »Fanatische Fantasy« von Reinhard Bingenger, FAZ vom 26.07.2011, S. 3). Einmal mehr zeigte sich, dass die Bemühung des Fundamentalismusbegriffs in solchen Debatten polarisiert aber nicht weiterhilft, zumal »Fundamentalismus« semantisch sehr verschieden interpretierbar ist.
Als wichtige Quelle für die Bewertung der Motive von Breivik gilt inzwischen das Kompendium 2083 – A European Declaration of Independence, das der mutmaßliche Mörder vor seiner grausamen Tat an einige Bekannte per eMail versandte. Ich habe das Dokument kurz überflogen und kann seitdem nachvollziehen, dass es einige Leser dazu verleitete, das faschistoide Weltbild Breiviks mit dem Christentum in Verbindung zu bringen. Der Autor sieht sich als Opfer eines marxistisch-islamischen Jihads und begründet sein Widerstandsrecht seitenweise mit Bibelstellen. Ungefähr so: »Die Bibel sagt uns, dass wir nun alle gute Soldaten Jesu Christi sind« (S. 1330).
Breivik hört jedoch nicht auf die Bibel, sondern missbraucht sie. Er deutet den christlichen Gauben und das Leben als jemand, der in den Tiefen seines Herzens mit einem sozialdarwinistischen Nationalismus sympathisiert. Ein Beispiel: Die sich selbst gestellte Frage, wie er sich ein vollkommenes Europa vorstellt, beantwortet er wie folgt (S. 1386, vgl. S. 350, 1227, 1232):
»Logik« und rationalistisches Denken (eine bestimmtes Größe [engl. degree] des völkischen Darwinismus) sollte das Fundament unserer Gesellschaften sein.
Ein Christ glaubt nicht an die Logik des Stärkeren. Jeder Mensch ist unabhängig von seiner Rasse, seinem Geschlecht oder seiner Performanz Ebenbild Gottes und besitzt somit eine unveräußerliche Würde. Christen halten Mord für eine schwere Sünde und wissen, »dass kein Menschenmörder ewiges Leben als bleibenden Besitz in sich trägt« (1Joh 3,15). Anders Breivik kann sich, das wird jeder eingestehen müssen, der seine Bibel wirklich gelesen hat, nicht auf einen Glauben berufen, der Nächsten- und Feindesliebe fordert und eindringlich davor warnt, das »Schwert« selbst in die Hand zu nehmen. Der listige Versuch, den vielfachen Mord an unschuldigen Menschen mit dem Recht auf Selbstverteidigung zu begründen (vgl. 1329f.), verdient unsere Verachtung.

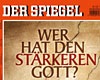 Wer wie ich über viele Jahre SPIEGEL-Abonnent gewesen ist, dürfte auch in diesem Jahr von der religionskritischen Weihnachtsausgabe kaum überrascht worden sein. Thomas Schirrmacher hat die »Fundamentalismusschelte« gelesen und einige Korrekturen vorgeschlagen:
Wer wie ich über viele Jahre SPIEGEL-Abonnent gewesen ist, dürfte auch in diesem Jahr von der religionskritischen Weihnachtsausgabe kaum überrascht worden sein. Thomas Schirrmacher hat die »Fundamentalismusschelte« gelesen und einige Korrekturen vorgeschlagen: