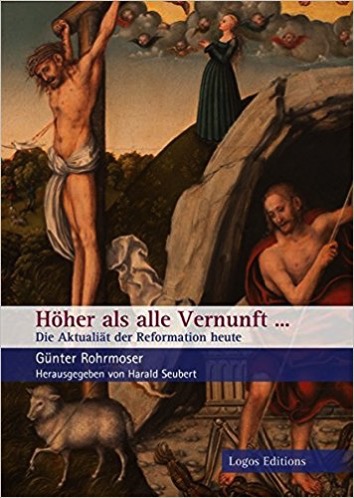 Harald Seubert hat aus dem Nachlass des Kulturphilosophen Günter Rohrmoser (1927–2008) ein Buch mit zwei außergewöhnlichen Vorlesungsreihen vorgelegt. Rohrmoser, der Philosoph und Theologe war, hielt eine große Paulusvorlesung, der sich eine Vorlesung über Luther anschloss.
Harald Seubert hat aus dem Nachlass des Kulturphilosophen Günter Rohrmoser (1927–2008) ein Buch mit zwei außergewöhnlichen Vorlesungsreihen vorgelegt. Rohrmoser, der Philosoph und Theologe war, hielt eine große Paulusvorlesung, der sich eine Vorlesung über Luther anschloss.
Die Kernbereiche der Lutherrezeption Rohrmosers stellen dabei die Römerbriefvorlesung, die Vorlesung zum Galaterbrief und vor allem die in einer breiteren Öffentlichkeit fast völlig vergessene, aber für Luthers Theologie zentrale Streitschrift „Vom unfreien Willen“ (De servo arbitrio) dar. Rohrmoser zeichnet unter kraftvollem Rückgriff auf Luthers Feder in brillanter Weise die von Paulus beschriebenen Heilslinien nach und klärt, hier Philosoph im besten Sinne des Wortes, über die Entwicklungen des aktuellen Zeitgeschehens im Lichte der biblischen Offenbarung auf. Mit erstaunlicher Sensibilität hat Rohrmoser vor über zwei Jahrzehnten theologische und geschichtliche Entwicklungen kommen sehen und sie mit geradezu prophetischer Scharfsicht vorweggenommen kommentiert. Das ganze Buch ist so ein Ruf zum Einsatz von Glauben und Vernunft als Diagnosemittel über den Zeichen dieser Zeit und damit, für den Philosophen, der davon überzeugt war, es gäbe nur die Alternative zwischen Christentum oder Barbarei, ein Ruf zum Wort Gottes, zum Kreuz, zu Christus.
Nachfolgend einige Zitate aus dem Buch:
Luther wusste, dass die Kirche, die eigene Kirche und Gemeinde, immer die schwerste Form der Anfechtung für den Christen bedeutet. Wir haben diese tiefe Einsicht im Allgemeinen vergessen und durch eine modische Friedlichkeit ersetzt. Luther hätte sich über Zustände wie die heutigen gar nicht gewundert, denn er hat vielfältig zum Ausdruck gebracht, dass der Antichrist die Neigung hat, seine Herrschaft gerade in der Mitte der Kirche zu errichten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Luther den Kampf gegen die damalige Gestalt der Kirche als den Kampf gegen die Herrschaft des Antichristen in der Kirche geführt hat. (S. 20)
Die Zukunft in unserer Welt wird jenen Mächten gehören, die von ihrer Wahrheit am überzeugtesten sind und am konsequentesten für sie einstehen. Wenn das Christentum aus dem deutschen Volk weichen sollte und aufhören sollte, eine geschichtliche, öffentlich wirksame, ja politische Kraft zu sein, wird dieses Vakuum nicht leer bleiben. Wir werden die liberalen Champagnerarien nicht noch weitere Jahrzehnte singen können, sondern werden Missionsland außereuropäischer Religionen werden, zuletzt wahrscheinlich Jünger Allahs. Wenn die Kirchenleitungen heute meinen, den Begriff Mission streichen zu müssen, werden wir von anderen erfolgreich missioniert werden. Wenn wir meinen, unsere Freiheit sei nicht mehr mit der Furcht Gottes zu vereinbaren, werden andere uns wieder zur Gottesfurcht zurückführen. Die Furcht Gottes ist aller Weisheit Anfang. Wenn sie nicht am Anfang steht, werden wir alle kleine Götter. (S. 21)
Was lag Luther am Evangelium? Er wusste, dass es die Wurzel der Freiheit ist. Es ist die Gabe und Kraft Gottes, die den Menschen befreit, ja die Freiheit des Menschen selbst erst befreit. Nur das Evangelium kann die natürlichen, intellektuellen, bürgerlichen Freiheiten des Menschen freisetzen und zur wirklichen Freiheit für den Menschen machen. Die ganze moderne Welt, auch mit ihren Häresien und Ideologien, steht und fällt damit, ob sie begreift, was Luther mit dieser Freiheit gemeint hat. Er hat nichts anderes gemeint, als dass die lebendige Kraft des Evangeliums die Menschen von Sünde, Tod und Teufel frei macht. (S. 22)
Das ganze Problem besteht darin, dass wir diese Sprache nicht mehr verstehen. Es ist kein Problem der Sache. Die Geistmächtigkeit unserer Theologen müsste sich darin erweisen, dass sie diese Mächte, Sünde, Tod und Teufel, heute als reale und uns versklavende Mächte unter uns aufdeckten. Das Christentum hat sich in der antiken Welt durchgesetzt und deren absterbende Kultur überwunden, weil seine Mitte die Botschaft der Auferstehung war. Auferstehung heißt, dass die Christen von einer Macht herkommen, die den Tod überwunden hat! „Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“ Unter den Christen ist heute dieser Lebensmut erstorben, der damals die niedergehende Kultur erneuerte. Das ganze orthodoxe Christentum ist bis heute, wo es lebendig ist, eine einzige Siegesfeier auf den Ruf „Christ ist erstanden!“. Aus dieser Kraft hat das russische Volk letztlich auch die grauenhaften Jahre des Sozialismus überstanden. (S. 22)
Der eigentliche Stein des Anstoßes bei Paulus, den Luther überdeutlich erfasst hat, ist der Begriff der Sünde. Die moderne Welt kann sich nahezu alle Elemente des Christentums aneignen, nicht aber die Lehre von der Sünde, dem peccatum. Auf dem Standpunkt der Autonomiethematik und des Autonomiepostulates des modernen Menschen ist der theologische Begriff der Sünde schlechterdings nicht assimilierbar. Das Autonomiepostulat steht dem entgegen. Es setzt voraus, dass das Ziel der Welt-und Menschheitsgeschichte größtmögliche Autonomie und menschliche Selbstverwirklichung ist. Mit diesem Ansatz des Autonomiepostulates ist der Begriff der Sünde unvereinbar, auch der unausgetragene Konflikt zwischen der Tradition des Christentums und der modernen Welt. (S. 51)
Mit dem Gericht rechnet heute keiner mehr. Mit dem Wegfall der Gerichtsvorstellung verblasst auch der Gedanke der Verantwortung. Nietzsche hat aber festgehalten, dass ohne Gericht der Ernst aus dem menschlichen Leben verschwindet. Nachdem die Aufklärung sehr erfolgreich die Gerichtsvorstellung eliminiert hat, fielen die Menschen anderen Menschen in die richtenden Hände, sie haben zwar das göttliche Gericht verneint, aber damit nahm die Geschichte selber die Form eines permanenten Gerichtes an, in dem wechselnde Menschen über andere permanent zu Gericht sitzen. „Tribunalisierung der Wirklichkeit“ ist dies treffend genannt worden (O. Marquard). Unsere Wirklichkeit ist so, dass jeder jeden jederzeit zur Rechenschaft ziehen kann und dass über ihn gerichtet wird. Nachdem die Aufklärung die Höllenvorstellung entfernt hat, ist sie in den Konzentrationslagern und den Gulagsystemen des 20. Jahrhunderts höchst konkret verwirklicht worden! (S. 241)
- Günter Rohrmoser, Höher als alle Vernunft …: die Aktualität der Reformation heute, hrsg. von Harald Seubert, Windsbach: Logos Editions, 2017, S. 304, € 19,90
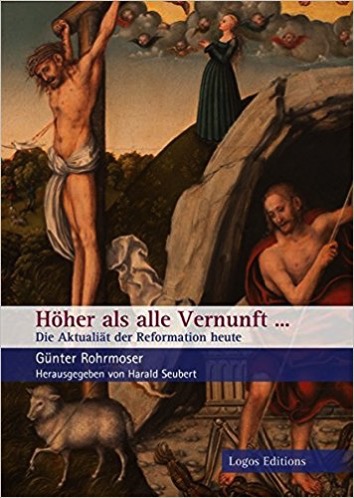 Harald Seubert hat aus dem Nachlass des Kulturphilosophen Günter Rohrmoser (1927–2008) ein Buch mit zwei außergewöhnlichen Vorlesungsreihen vorgelegt. Rohrmoser, der Philosoph und Theologe war, hielt eine große Paulusvorlesung, der sich eine Vorlesung über Luther anschloss.
Harald Seubert hat aus dem Nachlass des Kulturphilosophen Günter Rohrmoser (1927–2008) ein Buch mit zwei außergewöhnlichen Vorlesungsreihen vorgelegt. Rohrmoser, der Philosoph und Theologe war, hielt eine große Paulusvorlesung, der sich eine Vorlesung über Luther anschloss.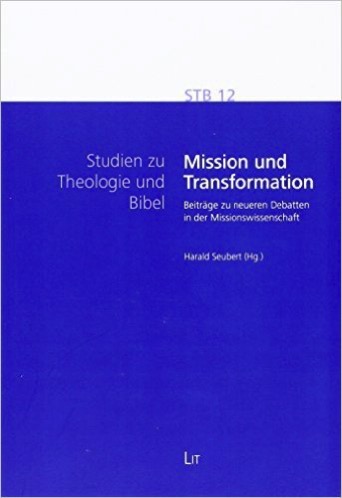 In den letzten Jahren hat die missionale Theologie weltweit für Aufsehen gesorgt. Ihre Vertreter leiten aus der Reich Gottes-Perspektive die kirchliche Verpflichtung ab, die Gesellschaft zu verändern, zum Beispiel, indem sie sich für den Umweltschutz oder „Soziale Gerechtigkeit“ einsetzen.
In den letzten Jahren hat die missionale Theologie weltweit für Aufsehen gesorgt. Ihre Vertreter leiten aus der Reich Gottes-Perspektive die kirchliche Verpflichtung ab, die Gesellschaft zu verändern, zum Beispiel, indem sie sich für den Umweltschutz oder „Soziale Gerechtigkeit“ einsetzen.
