Calvin: Schöpfung spiegelt die Unermeßlichkeit der Weisheit Gottes
Johannes Calvin schreibt in der Einleitung zu seinem Genesis-Kommentar (Auslegung der Genesis, 1956, S. 5):
In dem Wunderbau der Welt spiegelt sich die Unermeßlichkeit der Weisheit Gottes, aber menschliches Bemühen vermag nur eine unvollkommene Beschreibung zu geben von der Entstehung von Himmel und Erde. Unser Geist ist zu eng und schwach, um so gewaltige Dinge völlig zu fassen, und keine Sprache hat Ausdrücke, die dafür vollständig zuträfen.
Trotzdem erscheint es immerhin lobenswert, in Ehrfurcht und Bescheidenheit die Werke Gottes zu betrachten, mag gleich das Ziel nicht völlig erreicht werden. Und wenn ich mich anschicke, andern nach dem Maß der mir verliehenen Gabe bei solcher Betrachtung Handreichung zu tun, so darf ich hoffen, daß mein Bemühen Gott wohlgefällig sein und bei den Gottesfürchtigen Zustimmung finden wird. Diese Vorbemerkung diene zu meiner Entschuldigung; zugleich aber auch zur Mahnung an meine Leser, einen nüchternen, offenen, bescheidenen, demütigen Sinn mit herzuzubringen, wenn die gemeinsame Beschäftigung mit den Gotteswerken Gewinn bringen soll. Vor unsern Augen liegt die ganze Schöpfung ausgebreitet, unsre Füße stehen auf Gottes Erde, unsre Hände betasten seine Werke ohne Zahl in mannigfachster Art, wir atmen den süßen Duft von Kräutern und lieblichen Blumen, wir erfreuen uns im Genuß der reichsten Güter. Aber unsichtbar ruht in diesen wahrnehmbaren Dingen die unendliche Weisheit, Macht und Güte Gottes. Unser beschränkter Geist faßt das Unendliche, Grenzenlose nicht; ein bescheidenes Teil muß uns genügen. Und doch soll unser ganzes Leben sich dahin richten und jeder Fortschritt in der Erkenntnis noch im höchsten Alter unsere Freude sein.
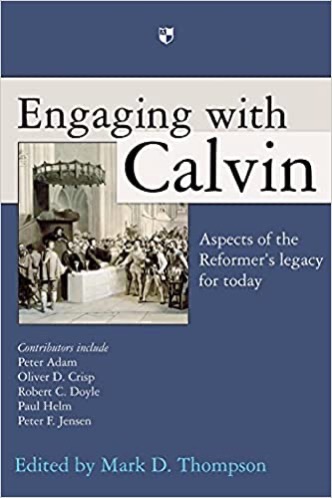 Peter Adam schreibt in „‚Preaching of a Lively Kind‘ – Calvin’s Engaged Expository Preaching“ (in: Mark D. Thompson (Hg.), Engaging with Calvin, S. 13–41, hier S. 13–14):
Peter Adam schreibt in „‚Preaching of a Lively Kind‘ – Calvin’s Engaged Expository Preaching“ (in: Mark D. Thompson (Hg.), Engaging with Calvin, S. 13–41, hier S. 13–14):