Den nachfolgend zitierten Brief schrieb der Reformator Martin Bucer am 13. Mai 1549 an den Bürgermeister von Straßburg. Bevor ich das Schreiben wiedergebe, einige Hintergrundinformationen:
Nach seinem Sieg im Schmalkaldischen Krieg von 1546/47 versuchte Kaiser Karl V. das Problem der Kirchenreform einer Lösung zuzuführen. Da das 1545 in Trient eröffnete und im März 1547 nach Bologna verlegte Konzil von Trient aufgrund des machtpolitischen Gegensatzes zwischen Kaiser und Papst keine Lösung brachte, strebte der Kaiser auf dem im September 1547 „geharnischten Reichstag“ zu Augsburg nach einem Kompromiss. Das Ergebnis war das am 30. Juni 1548 den Protestanten auferlegte sogenannte „Interim“. Während es die Wiedereinführung katholischer Zeremonien beim Gottesdienst und die Abkehr von der reformatorischen Theologie forderte, gewährte es den Protestanten die Priesterehe und den Laienkelch. Das Interim sollte bis zur Regelung durch ein allgemeines Konzil gelten. Da es heftig umstritten war, rief es großen Widerspruch hervor und musste in manchen Gebieten gewaltsam durchgesetzt werden (vgl. dazu W.D. Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, Bd. 2, 2010, S. 148–151).
Martin Bucer (1491–1551), der führende Kopf der Reformation in Straßburg und unermüdliche Kämpfer für die Einigung der reformatorischen Parteien, vor allem der Schweizer und Wittenberger, war am 1. März 1549 infolge der durch das Augsburger Interim geprägten politischen Verhältnisse auf Befehl des Kaisers vom Rat entlassen worden. Er wurde von verschiedenen reformatorischen Wirkungsstätten eingeladen, unter ihnen zu arbeiten, darunter Wittenberg, Bern, Kopenhagen und England. Bucer nahm das Angebot des Erzbischofs von Canterbury, Thomas Cranmer an, um als Königlicher Lektor der Schrift in Cambridge tätig zu werden. Dort half er, das Book of Common Prayer (dt. Gebetsbuch der Anglikanischen Kirche) zu verfassen und krönte seine Lebensarbeit mit einem Großentwurf für die Reformation in England: De Regio Christi.
Der konkrete Anlass des unten abgedruckten Briefes, den er gleich nach seiner Ankunft in England verfasste, war die Tatsache, dass Jakob Sturm dem politischen Druck nachgegeben und der Einführung des Interim in Straßburg zugestimmt hatte. So erklärt sich der ermahnende Duktus in dem Schreiben.
Ich zitiere nach: H.A. Oberman, Die Kirche im Zeitalter der Reformation, 5. Aufl., 2004, S. 229–230. Die einleitenden Anmerkungen zu Bucer und Sattler oben orientieren sich ebenfalls an diesem Werk.
Martin Bucer: Gottes Wort in Drucksituationen ehren
Gottes Ratschluß über uns und andere sollen wir nicht weiter erforschen, als er selbst geboten hat. Wenn aber offenkundig ist [patet], was der Herr gebietet, dann soll uns nichts davon abbringen; und was wir auch an Nachteilen für das Fleisch befürchten – wir sollen uns nicht bemühen, diese dadurch abzuwenden, daß wir auch nur einen Fingerbreit von den Geboten des Herrn abweichen. Dem Herrn gehört die Erde, also auch das Vaterland. Hier gab er uns de jure und de facto die Freiheit, nach unseren Vorstellungen zu leben, und diese hätte man sicher mit weit größerer Anstrengung festhalten müssen als alles andere. Deshalb hätte sich hier die Auffassung derer durchsetzen müssen, in denen Christus allermeist lebendig ist. Denn wenn die, die als Christen leben, zahlenmäßig auch nur einen winzigen Teil ausmachen, so ist auf sie, wenn sie in der Stadt des Herrn das Recht des Herrn verlangen, vor all den anderen zu hören, die doch nur Christi Reich und seine ganze Kraft bei uns beseitigen wollen, um nicht die Möglichkeit zu verlieren, weiter Geld anzuhäufen. Was der Herr bei den Türken, Römern und anderen Antichristen auch erleidet, hat uns nichts zu bedeuten. Wir wissen, was der Richter der Lebenden und der Toten von uns fordert, was er denen verheißt, die ihm gehorchen, und was er denen androht, die seine Befehle mißachten …
Als Du über die Menschen nachsannst, da mußtest Du daran denken, wie wenig es doch möglich ist, Gott zu gehorchen und seine Befehle auszuführen. Dazu kann ich nur eins sagen: Erinnere Dich daran, daß Gott allein es ist, der da wirket alles in allen [1Kor 12,6], allmächtig und ohne jeden Mangel [omnipotenter et optime]. Wenn Du aber auf den Gedanken verfällst, in irgendeiner Weise Gottes Gericht zu erforschen und ohne Ehrfurcht [irreligiosa] über die ewige Vorsehung Gottes nachzudenken, so bedenke: Wer bist du denn, daß du mit Gott rechten willst? [Röm 9,20]. Bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit [Röm 9,14], Ein Gefäß kann nicht zum Töpfer sagen: Warum hast du mich so gemacht? [Röm 9,20]. Dein Gericht, Herr, ist recht und bedarf keiner Rechtfertigung [Ps 19,10]. Es hat mich oft sehr beunruhigt, wenn ich Dir Worte Gottes vorhielt, daß ich dann Antworten von Dir bekam, die ich eher von einem erwartet hätte, der die Worte nicht ernst nimmt, als von einem, der sie als Gottes Worte verehrt.
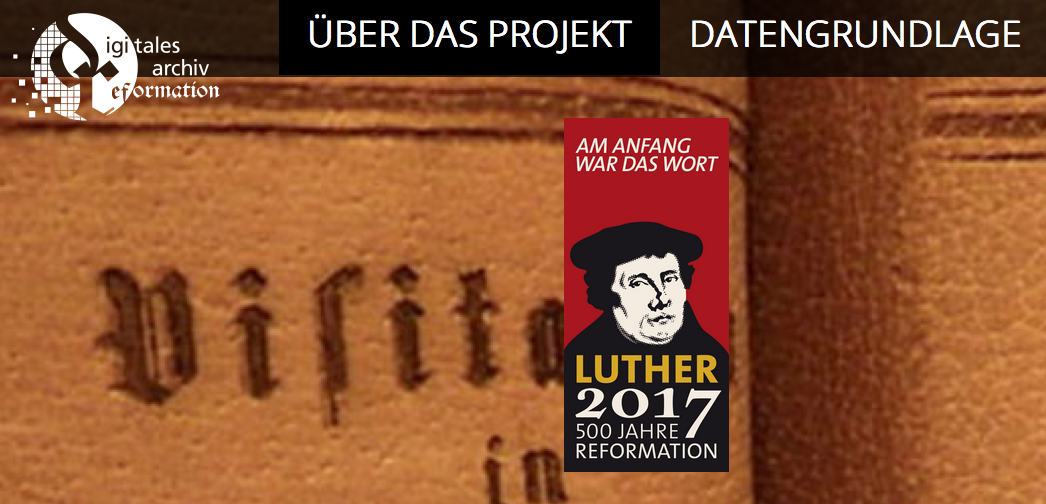
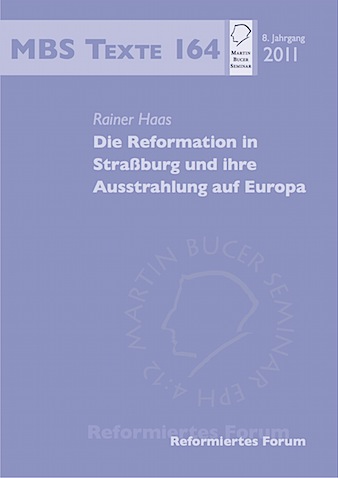 Ohne den Buchdruck hätten sich die reformatorischen Anliegen in Europa nicht ausbreiten können. Straßburg nahm bei der Reformation in doppelter Hinsicht eine Schlüsselstellung ein. Von der Stadt gingen maßgebliche theologische Impulse aus. Straßburg war außerdem eins der frühen Zentren des Buchdrucks, von dem aus ungezählte Bücher in die Welt versandt wurden.
Ohne den Buchdruck hätten sich die reformatorischen Anliegen in Europa nicht ausbreiten können. Straßburg nahm bei der Reformation in doppelter Hinsicht eine Schlüsselstellung ein. Von der Stadt gingen maßgebliche theologische Impulse aus. Straßburg war außerdem eins der frühen Zentren des Buchdrucks, von dem aus ungezählte Bücher in die Welt versandt wurden. Zur Zeit denken reformierte Christen zu Recht gern und viel an Johannes Calvin (1509–1564), da er 2009 seinen 500. Geburtstag feiert. Neben Martin Luther (1483–1546) gehören aber auch Huldrych Zwingli (1484–1531) und Martin Bucer (1491–1551) zu den großen Persönlichkeiten der Reformation. Gerhard Gronauer vergleicht auf 68 Seiten das Leben der beiden letztgenannten Reformatoren in einer übersichtlichen Zeittafel:
Zur Zeit denken reformierte Christen zu Recht gern und viel an Johannes Calvin (1509–1564), da er 2009 seinen 500. Geburtstag feiert. Neben Martin Luther (1483–1546) gehören aber auch Huldrych Zwingli (1484–1531) und Martin Bucer (1491–1551) zu den großen Persönlichkeiten der Reformation. Gerhard Gronauer vergleicht auf 68 Seiten das Leben der beiden letztgenannten Reformatoren in einer übersichtlichen Zeittafel: