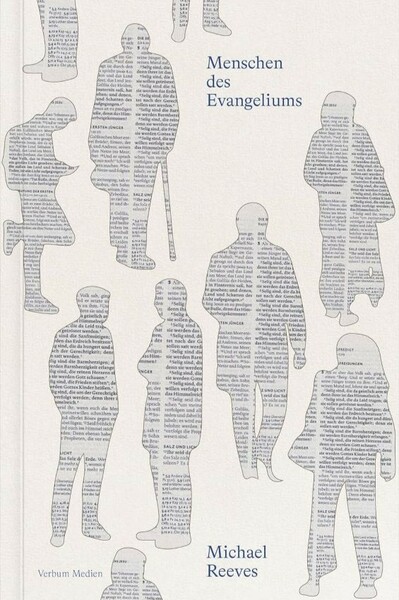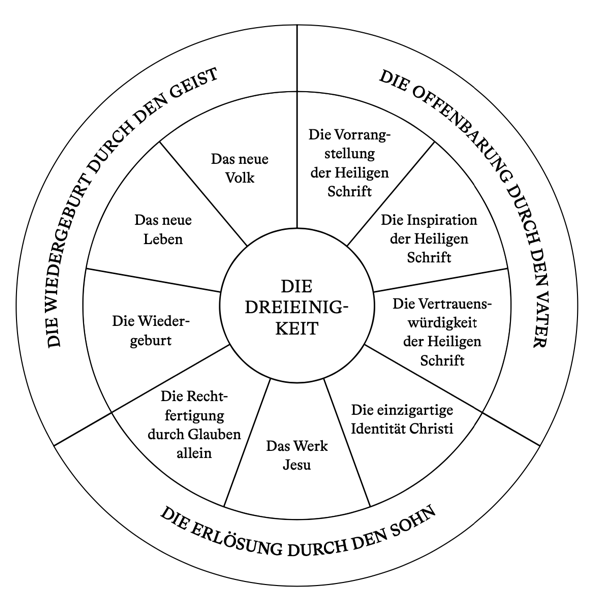Martyn Lloyd-Jones und die Puritaner
Philip Eveson schreibt in der Studie „Der Heilige Geist in der Lehre und Erfahrung von D. Martyn Lloyd-Jones“, dass Martyn Lloyd-Jones die Puritner sehr schätze und zugleich bemerkte, dass sie kritisch reflektiert werden sollten – besonders im Blick auf ihre Predigtlehre (Baptised With Heavenly Power: The Holy Spirit in the Teaching and Experience of D. Martyn Lloyd-Jones, 2025, S. 64–65):
Wie bei jedem historischen Thema, über das Lloyd-Jones sprach und Vorträge hielt, ging es ihm immer darum, es pastoral anzuwenden. Er schätzte die Puritaner wegen ihrer biblischen Herangehensweise an jede Situation und ihrem Misstrauen gegenüber dem, was Martin Luther als „die alte Hexe, Lady Vernunft” bezeichnete. Lloyd-Jones wies darauf hin, dass es bei der Kontroverse zwischen den Puritanern und der anglikanischen Kirche in hohem Maße um den Stellenwert der Vernunft ging. Weder die Vernunft noch die Tradition durften mit der Heiligen Schrift gleichgesetzt werden. Dennoch folgte Lloyd-Jones den Puritanern nicht sklavisch. Im Rahmen einer Vorlesung über Predigen am Westminster Seminary im Jahr 1967 zeigte er, wie sehr er die Puritaner bewunderte, und fügte diese persönliche Anmerkung hinzu: „In gewisser Weise bin ich vielleicht dafür verantwortlich, dass das Interesse an ihnen in Großbritannien wiederbelebt wurde.” Doch im nächsten Atemzug gab er folgende Warnung: „Die Puritaner können aus der Sicht der Predigt sehr gefährlich sein.“ Seiner Meinung nach waren sie „in erster Linie Lehrer … und keine Prediger“. Diese Aussage stand in klarem Widerspruch zu dem, was er einige Jahre später am selben Seminar sagte, wie im vorigen Absatz erwähnt, nämlich dass die Puritaner „praktische, experimentelle Prediger“ waren! Hier muss bei jeder Bewertung der Ansichten von Lloyd-Jones, insbesondere seiner kontroverseren Aussagen, der Kontext berücksichtigt werden, in dem er gesprochen hat. Was den Aufbau ihrer Predigten angeht, waren die Puritaner nicht dafür bekannt, schön abgerundete Predigten zu halten, die eine Botschaft eindringlich vermittelten, und in diesem Sinne waren sie eher Lehrer als Prediger. Dennoch hatten sie durch die Auslegung des Textes, die Hervorhebung seiner kostbaren Wahrheiten und die Bereitstellung einer durchdachten Anwendung etwas Wichtiges zu sagen, und sie sagten es mit einer Überzeugung und Autorität, die von der Kraft Gottes zeugte. Er sah in den Puritanern das „lebendige Element”, das die Verkündigung des Wortes Gottes durch die Jahrhunderte begleitet hatte, von der apostolischen Predigt in der Apostelgeschichte bis hin zu den Führern der walisischen calvinistischen Methodisten.