Dane Orlund: 39 Predigtregeln
Dane Ortlund, Autor von Gütig und Sanft sowie Tiefer (#ad), hat seine 39 Predigtregeln, nach denen er jede Predigt zu gestalten versucht, veröffentlicht. Mit seiner freundlichen Genehmigung darf ich sie hier wiedergeben:
- Jesus predigte Frieden (Eph 2,17); sei kein besserer Prediger als Jesus.
- Predige zuerst dir selbst.
- Predige aus deinem Herzen, nicht nur zu ihren Herzen.
- Nutze deine eigene Notlage.
- Wie sehr musst du die Menschen hassen, um sie beeindrucken zu wollen, anstatt ihnen zu helfen?
- Ein durchgängiger Ton der Ermutigung.
- Lebendige Bilder. Innerlich, sinnlich. Wenig Rot mit Analogien.
- Sie sind verzweifelter, als sie zeigen.
- Die Kraft liegt im Wort, nicht in deiner Klugheit.
- Der Geist wirkt mit deiner Schwäche und deiner Not, nicht mit deiner Stärke und Ihrer Vollkommenheit.
- Denke dich satt, bete dich strahlend.
- Sei konkret, nicht abstrakt.
- Konkretheit vermittelt Universalität.
- Sei klar. Lewis: Schafe. Wenn du ihnen einen Weg zum Missverständnis bietest, werden sie ihn nehmen.
- Sei einfach, aber nicht simplistisch.
- Streiche alles Überflüssige gnadenlos.
- Lächle. Und meine es ernst. Predigen ist ein Akt pastoraler Liebe.
- Lehre allein reicht nicht aus, aber die Menschen wollen die Lehre kennenlernen.
- Zeige regelmäßig etwas von deiner eigenen Schwäche.
- Teilen ihnen deine neuen exegetischen Entdeckungen mit.
- Verlange nicht von Adjektiven, die Arbeit zu leisten, die Verben leisten sollten.
- Mache das Evangelium an einer Stelle deutlich.
- Es sind sowohl Ungläubige als auch Gläubige anwesend.
- Es sind sowohl eifrige als auch stagnierende Gläubige anwesend.
- Denke an die Kinder und spreche sie direkt an.
- Spreche mit deiner natürlichen Alltagsstimme; widerstehe jeder Form der „Predigerstimme”.
- Gehe mit Einwänden um.
- Wenn du unsicher bist, ist kürzer besser.
- Höre mit der Predigt auf, solange du noch Zuhörer hast.
- Du siehst nicht so glücklich aus, wie du bist; strecke dich also nach Freude aus.
- Wenn sie sich von dir geliebt fühlen (vgl. Phil 4,1), werden sie mit dir leiden (vgl. Phil 4,14).
- „Wir werden dich noch einmal darüber hören“ (Apg 17,32). Wecke ihr Interesse an Jesus, auch wenn sie sich noch nicht in seine Arme geworfen haben.
- Lass deine Hauptpunkte nicht auf andere Texte in der Bibel übertragbar sein.
- Verlangsame das Tempo, um jedes einzelne Wort des Textes wahrzunehmen – was er sagt und was er nicht sagt.
- Beruhige dich und seien du selbst.
- Sei ein Landwirt, kein Penny-Stock-Händler. Crockpot (elektrischer Schongarer), keine Mikrowelle.
- Gebrauche keine Beredsamkeit, gebrauche lieber Ausstrahlung.
- T.F. Tenney: „Predige jede Predigt so, als säße dein Sohn in der letzten Reihe und gäbe der Kirche eine letzte Chance.“
- Tinktur. Gib ihnen einen Vorgeschmack darauf, wie Jesus selbst ist. Rutherford.
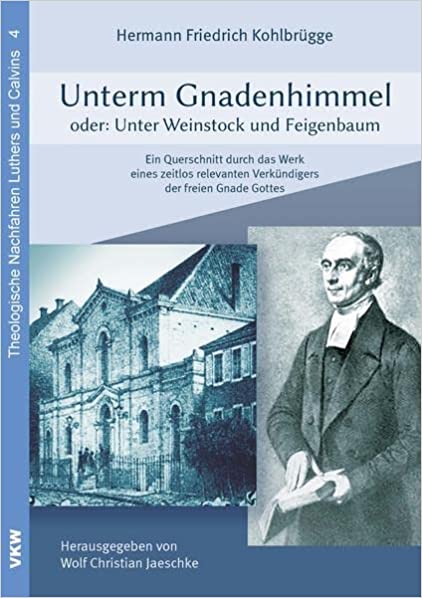 Wolf Christian Jaeschke schreibt in dem gerade von ihm herausgegebenen Buch
Wolf Christian Jaeschke schreibt in dem gerade von ihm herausgegebenen Buch 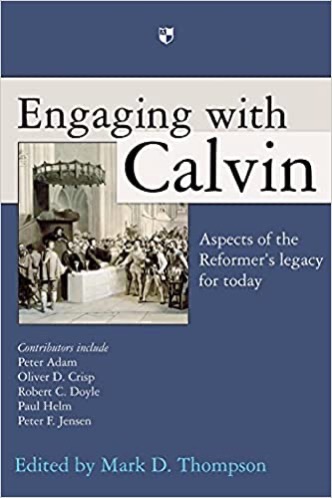 Peter Adam schreibt in „‚Preaching of a Lively Kind‘ – Calvin’s Engaged Expository Preaching“ (in: Mark D. Thompson (Hg.), Engaging with Calvin, S. 13–41, hier S. 13–14):
Peter Adam schreibt in „‚Preaching of a Lively Kind‘ – Calvin’s Engaged Expository Preaching“ (in: Mark D. Thompson (Hg.), Engaging with Calvin, S. 13–41, hier S. 13–14):