Vom Glück der Selbstkontrolle
Selbstkontrolle (gr. ἐγκράτεια) wird schon in der Bibel sehr hoch bewertet. Wem sie fehlt, „der ist blind, kurzsichtig, der hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von den einst begangenen Sünden“ (2Petr 1,9). Von einem Gemeindeleiter wird sogar erwartet, dass er sich selbst beherrschen kann (vgl. Tit 1,8).
Eine junge Psychologiestudie bestätigt die Güte der Selbstbeherrschung. Menschen, die sich nicht vom Spass oder dem kurzweiligen Glücksgefühl „einfangen lassen“, leben zufriedener.
Selbstdisziplinierten Menschen sagt man nach, eher grimmige und freudlose Zeitgenossen zu sein. Klar, sie halten bei Diäten länger durch, können sich besser zu Sport motivieren, sind vermutlich ausgeschlafener und im Job erfolgreich. Studien zeigen: Wer schon als Kind eher diszipliniert handelte, ist als Erwachsener gesünder, hat weniger finanzielle Probleme und kommt seltener in Konflikt mit dem Gesetz. Aber Menschen, die aus Vernunft Salat einer Schokoladentorte vorziehen oder auf einer Party nur Brause trinken, weil sie drei Tage später eine Prüfung haben, können doch keinen Spaß am Leben haben. Oder? Sehr wohl haben sie das, wie jetzt eine Studienreihe im „Journal of Personality“ von deutschen und US- amerikanischen Psychologen um Wilhelm Hofmann von der University of Chicago belegt. Demnach erleben Menschen mehr positive Gefühle und sind zufriedener mit ihrem Leben, wenn sie sich gut im Griff haben – und Bedürfnisse aufschieben können, um ein anderes wichtigeres Ziel zu erreichen. Die Forscher befragten zunächst mehr als 400 Männer und Frauen, wie viel Selbstkontrolle sie im Alltag zeigen. Die meisten Menschen nutzen diese Fähigkeit oft und automatisch: In der Regel geben wir von fünf Impulsen nur zweien tatsächlich nach. Doch individuell handelt natürlich jeder verschieden. Personen, die gerne mal etwas tun, was eigentlich schlecht für sie ist, aber eben Spaß bringt, ordneten die Wissenschaftler in die Kategorie der weniger selbstdisziplinierten Menschen ein.
Mehr: www.spiegel.de.
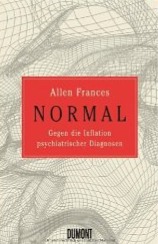 Allen Frances gilt weltweit als einflussreicher Psychiater. Der Name des inzwischen emeritierten US-amerikanischen Professors ist eng verwoben mit der „Bibel der Psychiatrie“, dem Diagnostischen Handbuch Psychischer Störungen (DSM). Es enthält alle wissenschaftlich anerkannten psychischen Erkrankungen.
Allen Frances gilt weltweit als einflussreicher Psychiater. Der Name des inzwischen emeritierten US-amerikanischen Professors ist eng verwoben mit der „Bibel der Psychiatrie“, dem Diagnostischen Handbuch Psychischer Störungen (DSM). Es enthält alle wissenschaftlich anerkannten psychischen Erkrankungen. Jörg Albrecht hat für die FAZ eine kleine Geschichte des Rorschach-Tests geschrieben.
Jörg Albrecht hat für die FAZ eine kleine Geschichte des Rorschach-Tests geschrieben.